Immer mehr Prüfungen werden als „Open-Book-Klausuren“ geschrieben. Ist das die Zukunft der Wissensüberprüfung?
In Zeiten der Pandemie ist es nicht möglich, Klausuren mit teilweise hunderten Studierenden in einem Saal zu veranstalten. „Alles online“ lautet die Devise. Während das für mündliche Prüfungen als Einzelgespräch mit Webcam und Mikrofon noch verhältnismäßig leicht umzusetzen ist, sieht es bei schriftlichen Klausuren schon schwieriger aus. Wie soll man so viele Prüflinge gleichzeitig überwachen und sichergehen, dass nicht – außerhalb des von der Kamera eingefangenen Bereichs – Möglichkeiten zum Betrug verborgen sind? Quasi unmöglich. Immer häufiger fällt daher der Begriff „Open Book“.
Spicken erwünscht
Die als Open-Book- oder Kofferklausur bezeichnete Prüfungsform ist eine Variante schriftlicher Klausuren, bei der so ziemlich jedes papierne Hilfsmittel – seien es Mitschriften, Skripte oder Lehrbücher – zugelassen ist. Das ist keine neue Idee, spätestens seit der Prüfungsphase unter Pandemiebedingungen aber in aller Munde.
Das Spicken nicht mehr zu verbieten ist natürlich eine sehr effektive Methode, Betrugsversuche zu vermeiden. Aber steht das nicht der Essenz einer Prüfung – gelerntes Wissen abzurufen – entgegen? Die Antwort ist, wie bei vielen Fragen: Es kommt darauf an. Offensichtlich ergibt eine Vokabelkontrolle, bei der man jederzeit ins Wörterbuch schauen kann, wenig Sinn. Besonders auf Hochschulniveau und erst recht in der Arbeitswelt ist jedoch häufig Anwendung und Erweiterung eher gefragt als Replikation. Solche Transferaufgaben erfordern es, den gelernten Stoff neu zu verknüpfen und über ihn hinauszudenken – Lösungen dafür findet man also nicht im Vorlesungsskript. Demnach wäre es unerheblich, ob man während der Prüfung Zugang dazu hat. Ja, es ist sogar erwünscht, auf die blanke Information zurückzugreifen, um seine geistigen Kapazitäten auf die tatsächliche Denkleistung zu fokussieren.

Der Status quo
Das Stichwort „Prüfungsphase“ ruft bei vielen wohl das Bild des Studierenden in den Kopf, der über Mitschriften und Büchern hängt, um das darin Geschriebene möglichst gut in seinen Kopf zu bannen. Doch wäre es nicht weitaus effektiver und nachhaltiger, Konzepte verstehen zu wollen, statt Informationen zu speichern? Diese bleiben nämlich nicht nur länger im Gedächtnis, sondern können auch auf verwandte Themen erweitert und angewandt werden. Zudem ist es realitätsnäher: Welcher Arbeitgeber würde es verbieten, irgendetwas noch einmal nachzuschlagen? Für Selbstständige gäbe es nicht einmal jemanden, der sie daran hindert.
Jedoch ist das Prinzip der Anwendungs- und Transferaufgaben nicht die Lösung aller Probleme: Zum einen ist es komplizierter, sie zu erstellen. Eine Frage zu konstruieren erfordert ebenso viel Denkleistung, wie sie zu beantworten (was das Formulieren eigener Fragen auch zu einer ausgezeichneten Lernstrategie macht). Zudem wären auch alle Altklausuren Teil von „alle Hilfsmittel“, sodass keine Aufgabe recyclet werden könnte. Open Book bedeutet also einen deutlichen Mehraufwand für die Prüfer:innen. Ob sie die Zeit dafür nicht haben oder sich nicht nehmen wollen, ist irrelevant. Schlussendlich könnte es ein Grund sein, weshalb mancher so innig an seinen seit Jahren mit wenig Varianz auftretenden Aufgabensammlungen hängt.
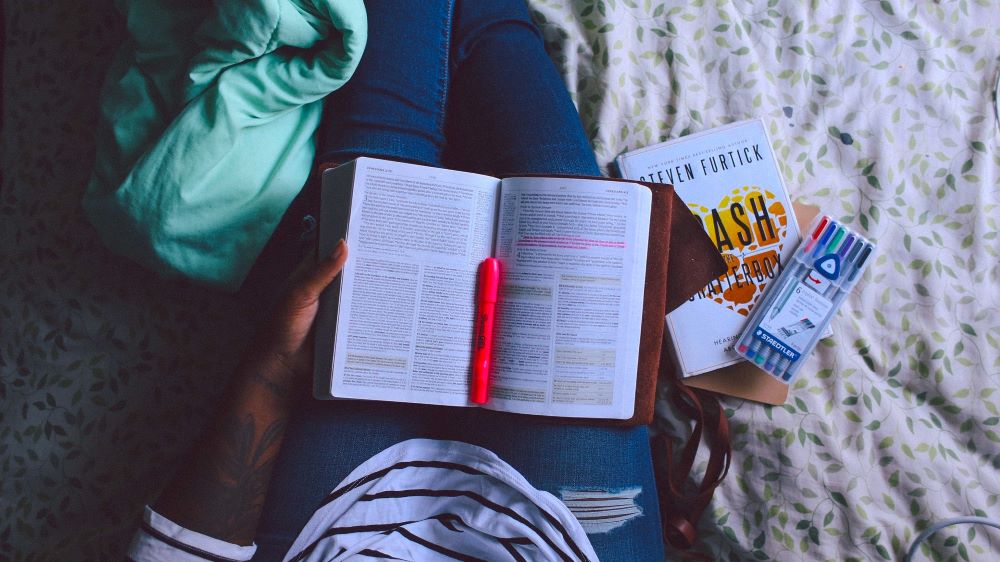
Auch nicht jeder Studierende ist begeistert. Je mehr Hilfsmittel erlaubt sind, desto schwieriger seien die Aufgaben, heißt es manchmal. Mathematisch betrachtet wären Aufgaben in Open-Book-Klausuren demnach unendlich schwer – die Korrelation hinkt also. Die Annahme kommt aber natürlich nicht von ungefähr. Auswendig zu lernen und zu reproduzieren erfordert quasi keine Denkleistung. Aus dem Gelernten muss nicht Neues abgeleitet, keine Zusammenhänge hergestellt werden. Nur ein bisschen Fleiß ist nötig. Das ist allerdings auch der größte Kontrast zu „moderneren“ Aufgabentypen. Lange Lernsessions, bis man von Karteikarten träumt, sind nicht nötig. Verständnisfragen haben von Vornherein ein anderes Ziel. Sie dienen nicht dazu zu überprüfen, ob eine reine Information gespeichert wurde – im Computerzeitalter haben wir dafür zuverlässigere Wege als das menschliche Gehirn –, sondern ob aus den Informationen ein Konzept erschlossen wurde, das modifiziert, erweitert und in der Realität angewandt werden kann. Das ist anstrengend – und soll es auch sein –, denn so müssen die Studierenden etwas Eigenes schaffen.
Was lernen wir daraus?
Sollen jetzt also nur noch Open-Book-Klausuren geschrieben werden, soll kein:e Studierende:r jemals wieder Karteikarten schreiben? Die Antwort ist ein klares Nein. Es spart Zeit, Dinge im Gedächtnis zu haben. Was man weiß, muss man nicht nachschlagen. Viel wichtiger: Was man nicht kennt, kann man auch nicht in einen Zusammenhang bringen. Zumindest grob sollte man sich also die wichtigsten Punkte einprägen; der Fokus sollte allerdings nicht zu sehr auf den Details liegen.
Schlussendlich muss ein Mittelweg gefunden werden. Professor:innen müssen kreativer bei der Erstellung ihrer Klausuren werden und Studierende williger, ihren Kopf anzustrengen. Auswendig gelerntes Wissen sollte als Werkzeug wahrgenommen werden. Eine Prüfung sollte keine Inventur dessen sein, sondern ein Probelauf, es anzuwenden.
Open-Book-Klausuren sind dabei ein Schritt in die richtige Richtung. Das allerdings nur, wenn sie als die Chance zu eigener Kreativität und Denkleistung verstanden werden, die sie sind.

Aus diesem Blickwinkel habe ich die “Open Book”-Debatte noch nicht gesehen. Super Artikel!