Sie zählen Zugvögel, sie teilen Mittagessen aus, sie schneiden Radiosendungen – Freiwilligendienstleistende widmen ein Jahr ihres Lebens dem gesellschaftlichen Engagement. Doch welche Anerkennung findet das? Ein Kommentar.
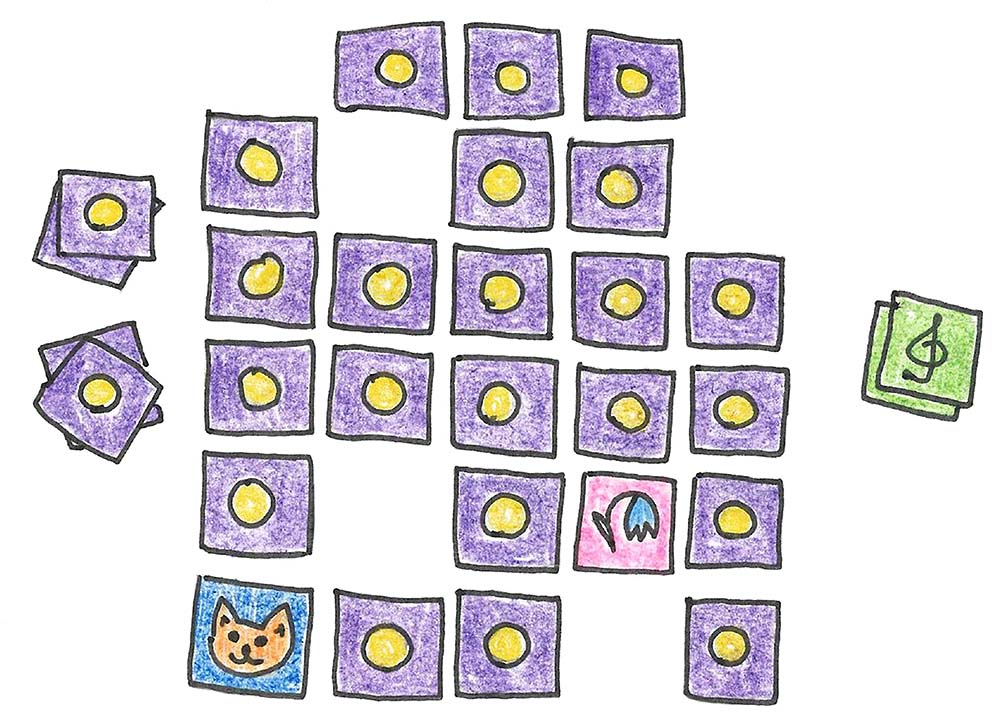
in sozialen Tageseinrichtungen wie Jugendclubs oder Demenzbetreuungen, …
Zuallererst will ich mich outen: Ich bin Fan. Jugendfreiwilligendienst ist meiner Ansicht nach der absolute Shit! Die Idee, dass junge Menschen ein Jahr lang in sozialen, ökologischen oder kulturellen Einrichtungen mitarbeiten und dabei die einen von den anderen lernen und umgekehrt – wie geil ist das bitte? Ich will auch behaupten, etwas Ahnung zu haben. Neben der Erfahrung eines eigenen FSJs nach dem Abitur in Jugendclub, Bibliothek und Touristinformation meines Heimatortes begleite ich, als Nebenjob zum Studium, nun im fünften Jahr Freiwillige aus dem Thüringer Kultur- und Politikbereich auf ihren Bildungsseminaren. Dabei habe ich Einblicke in die Perspektiven von Trägern, Einsatzstellen und einer dreistelligen Zahl Freiwilliger bekommen und das hat mich zu meiner Überzeugung gebracht: Ja, Jugendfreiwilligendienst ist der absolute Shit!
Meinem Eindruck nach teilen diese Ansicht jedoch nicht viele. Gesellschaftliche Debatten um das Thema sind beladen mit vielen Widersprüchen und Ignoranz, bei denen vor allem eine Instanz immer wieder verliert: die Gesellschaft selbst.
Zahlen bitte!
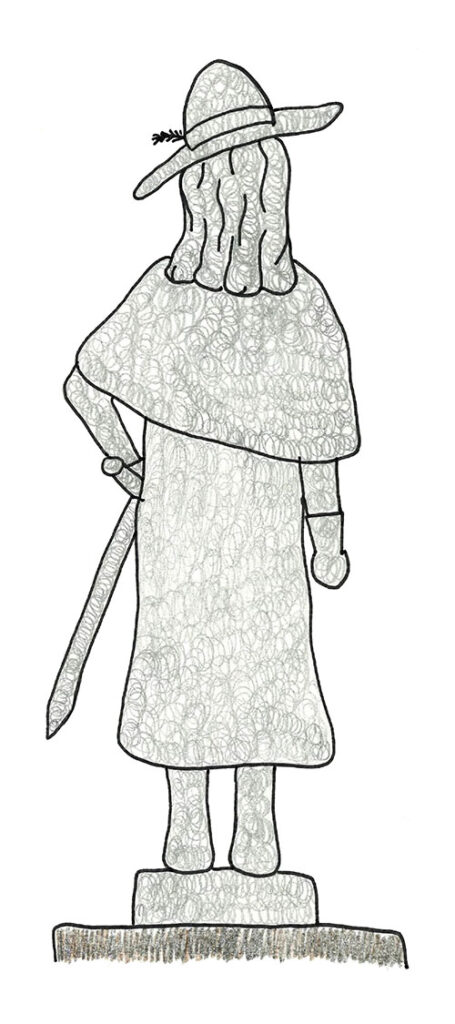
2023 wurde eine Petition eingereicht: Über 100 000 Unterschriften konnten gesammelt werden, um gegen die für 2024 geplanten Bundeshaushaltskürzungen im Bereich der Freiwilligendienste zu protestieren. Es gelang tatsächlich, die Kürzungen von 78 Millionen Euro wurden ausgesetzt. Doch der Erfolg währte nur kurz. Der Kabinettsentwurf für den Bundeshaushalt 2025, der im darauffolgenden Juli vorgelegt wurde, sah nun eine finanzielle Einsparung von etwa 40 Millionen Euro vor – das sind Kürzungen um 12 Prozent. Für die Freiwilligendienste stellt dies eine Zäsur dar. Die Bundesfinanzierung war in den Jahrzehnten zuvor recht stabil gewesen. Die Ampel-Koalition hat wegen ihrer Auflösung keinen Bundeshaushalt für 2025 beschlossen, das wird vermutlich erst durch die neu gewählte Regierung erfolgen. Wie es mit den Freiwilligendiensten finanziell weitergeht, ist daher unklar.
Doch diese Ungewissheit ist eine große Belastung für die Träger und die Einsatzstellen, da im Winter die Bewerbungsphase und Planung für den nächsten Jahrgang auf Hochtouren laufen. Dass ein Freiwilligenjahrgang von zwei Haushalten abhängig ist – er startet im September des einen und endet im August des nächsten Jahres – erschwert die Sache zusätzlich. Ohnehin: Wie so vieles in Deutschland ist auch die Finanzierung von Freiwilligendiensten ein bisschen unübersichtlich. Etwas Geld kommt vom Bund, der Föderalismus glänzt in seinen 16 Facetten, von manchen Bundesländern werden EU-Gelder angezapft – es ist ein wahres Fest. Gleiches gilt auch bei rechtlichen Fragen wie etwa der Unterscheidung in Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) und Bundesfreiwilligendienst (BFD).
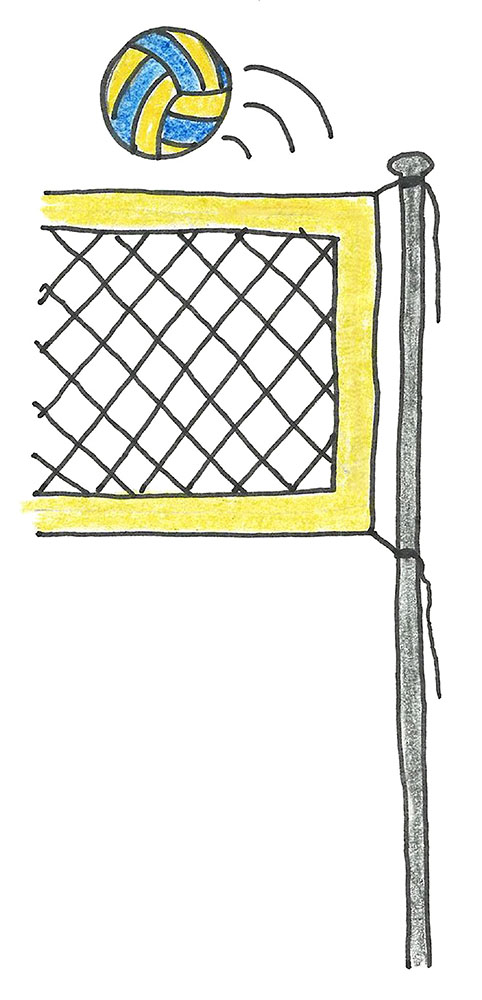
Unterm Strich lässt sich sagen: Derzeit absolvieren jährlich etwa 55 000 Menschen einen Jugendfreiwilligendienst innerhalb Deutschlands oder im Ausland. Mit den angedachten Kürzungen würde sich diese Zahl spürbar verringern. So wichtig scheint der Jugendfreiwilligendienst ja nicht zu sein.
Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Diskussionen über einen verpflichtenden Dienst für junge Menschen. Vor allem der Ukrainekrieg und die aufflammende Debatte um die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht spielen dabei eine Rolle. CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz verkündete im Rahmen seines Wahlkampfes, er wolle als Regierungschef ein „verpflichtendes Gesellschaftsjahr“ einführen; dieses Mal für Männer und Frauen – der Mann ist schließlich Feminist! Im Rahmen dessen soll der Grundwehrdienst und alternativ eine Art Zivildienst obligatorisch werden.
Doch nicht nur in rechts-konservativen Kreisen findet die Idee der Verpflichtung Anklang. Der SPD-Fraktionsvize des Bundestages Dirk Wiese forderte im Sommer 2023 einen sozialen Pflichtdienst für junge Menschen von mindestens drei Monaten. Der Rheinischen Post sagte er dazu: „Wir brauchen wieder mehr Respekt im Umgang und ein stärkeres Miteinander im Land.“ Auch Aminata Touré (Die Grünen), Sozialministerin Schleswig-Holsteins, sprach sich 2024 für eine Pflicht aus, nachdem sie sich zwei Jahre zuvor noch dagegen positioniert hatte.
Wie stellen Sie sich das vor, Herr Merz?
Touré selbst meint, sie wisse, dass die Thematik polarisiere, da eine Pflicht einen Eingriff in die individuelle Freiheit darstelle. Tatsächlich handelt es sich dabei um das zentrale Argument bei Debatten gegen ein Pflichtjahr. Und ja, das ist grundsätzlich ein Gegenstand, den es zu diskutieren gilt, stellt dabei aber auch nur die Spitze des Eisberges an Problemen dar, die sich rund um eine mögliche Verpflichtung auftun.
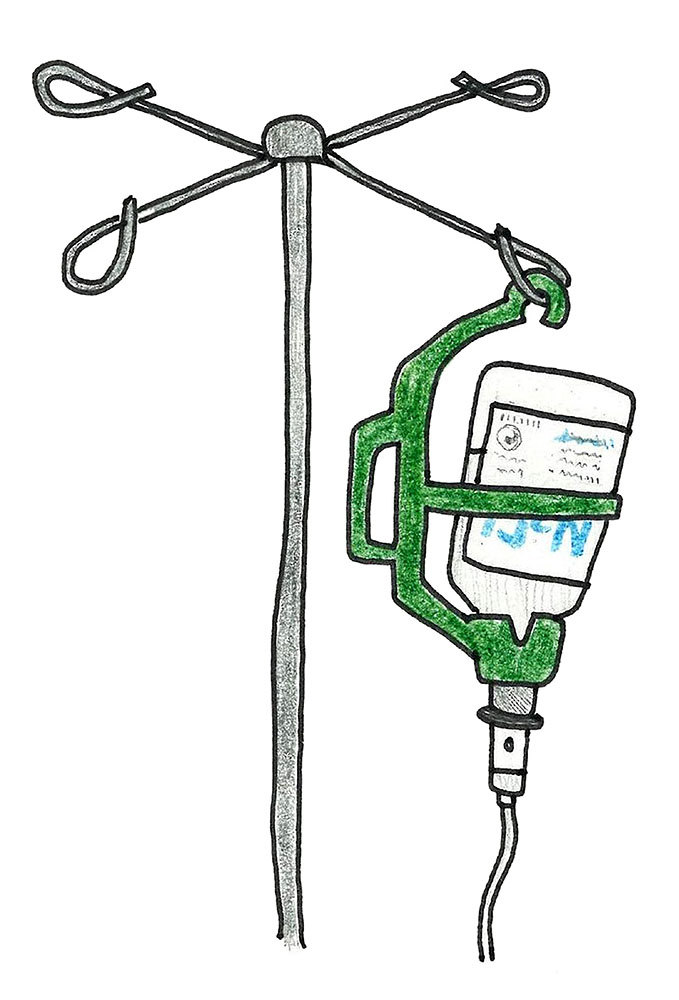
Während immer wieder darüber geredet wird, welche Bereicherung Freiwillige für die Einsatzstellen darstellen, wird allzu gern der damit einhergehende Aufwand vergessen. Jedes Jahr müssen Einrichtungen aufs Neue Menschen einarbeiten und betreuen, deren Tätigkeit nach dem Prinzip der Arbeitsmarktneutralität keine bezahlte Arbeit ersetzen darf. Wie hoch dürfte dieser Aufwand nun sein, wenn da ein junger Mensch vor einem steht, der schlichtweg keine Lust hat? Wie viel ist ein Sozialdienst wert, der nicht aus freiwilligem Geben und Lernen, sondern verdonnertem Sich-mitschleifen-Lassen besteht?
Andererseits würden zahllose Dienstleistende in Einrichtungen landen, die den Job des Mentorings nicht ordentlich ausfüllen (können). Wie gesagt, die Anleitung und Förderung durch die Einsatzstelle ist auch mit Arbeit verbunden. Das will gelernt sein und muss wiederum auch angeleitet und kontrolliert werden. Die Mitarbeitenden von Freiwilligendienstträgern begleiten die Dienstleistenden unabhängig ihrer Einsatzstellen und agieren oft als Mediator:innen bei Problemen, die zwischen Freiwilligen und Einrichtung auftreten. Sie haben ein liebevolles Auge darauf, ob das Jahr ohne Ausbeutung, Druck oder systematische Langeweile verläuft. Diese Aufgabe ist äußerst wichtig und gleichzeitig würde eine große Zahl neuer Einsatzstellen besonders viel Aufmerksamkeit verlangen.
Doch auch da ist es mit dem fehlenden Personal nicht vorbei. Es fehlt an passenden Strukturen in der Bundeswehr und es braucht neue Musterungseinrichtungen und Ministeriumsstellen, in denen Verweigerungsschreiben geprüft werden. All diese Strukturen wurden mit dem Aussetzen der Wehrpflicht abgebaut und müssten jetzt im doppelten Maße wieder neu errichtet werden, da nun auch Frauen verpflichtet werden sollen. Friedrich Merz sprach von 700 000 Menschen pro Jahrgang.
Das liebe Geld
Grundsätzlich würde ich an dieser Stelle einmal die Frage in den Raum werfen, wer das alles bezahlen soll. Wenn in einem Bundeshaushalt nicht einmal 40 Millionen Euro für den Erhalt bestehender Konzepte aufgetrieben werden können, wo soll das Geld für einen verpflichtenden Dienst herkommen? Zudem muss eine potentielle Pflicht all zu gerne als tolle Lösung für den krassen Personalmangel im sozialen Sektor herhalten. Da werden schöne Bilder gemalt von einer Oma im Pflegeheim, die endlich jemanden hat, mit dem sie Halma spielen kann. Doch wieso nicht direkt das Geld in deutlich bessere Arbeitsbedingungen investieren, sodass endlich wieder mehr Menschen im sozialen Sektor arbeiten können und wollen? Oft wird dann auf die Tatsache verwiesen, dass 70 Prozent aller Freiwilligen, die einen sozialen Jugenddienst ableisten, auch später in der Branche arbeiten. Aber durch eine Pflicht werden doch nicht automatisch mehr Menschen überzeugt. Und an den miesen Arbeitsbedingungen ändert das auch nichts.
Tatsächlich ist es einfach so: Dienstleistende sind billig. Der Höchstbetrag für das Taschengeld im FSJ und BFD liegt 2025 bei 644 Euro für eine Vollzeitstelle. So viel Geld bekommen die Wenigsten. In Thüringen, wo ich arbeite, sind es im Kulturbereich momentan 350 Euro monatlich; hier in Sachsen-Anhalt ganze 7,50 Euro mehr. Es ist einfacher, jeden Jahrgang für zwölf Monate und kaum Geld in soziale Einrichtungen zu stecken, statt Mittel in die Hand zu nehmen und langfristige Lösungen zu schaffen. Nachhaltigkeit ist halt wirklich keine Stärke der Boomer:innen …
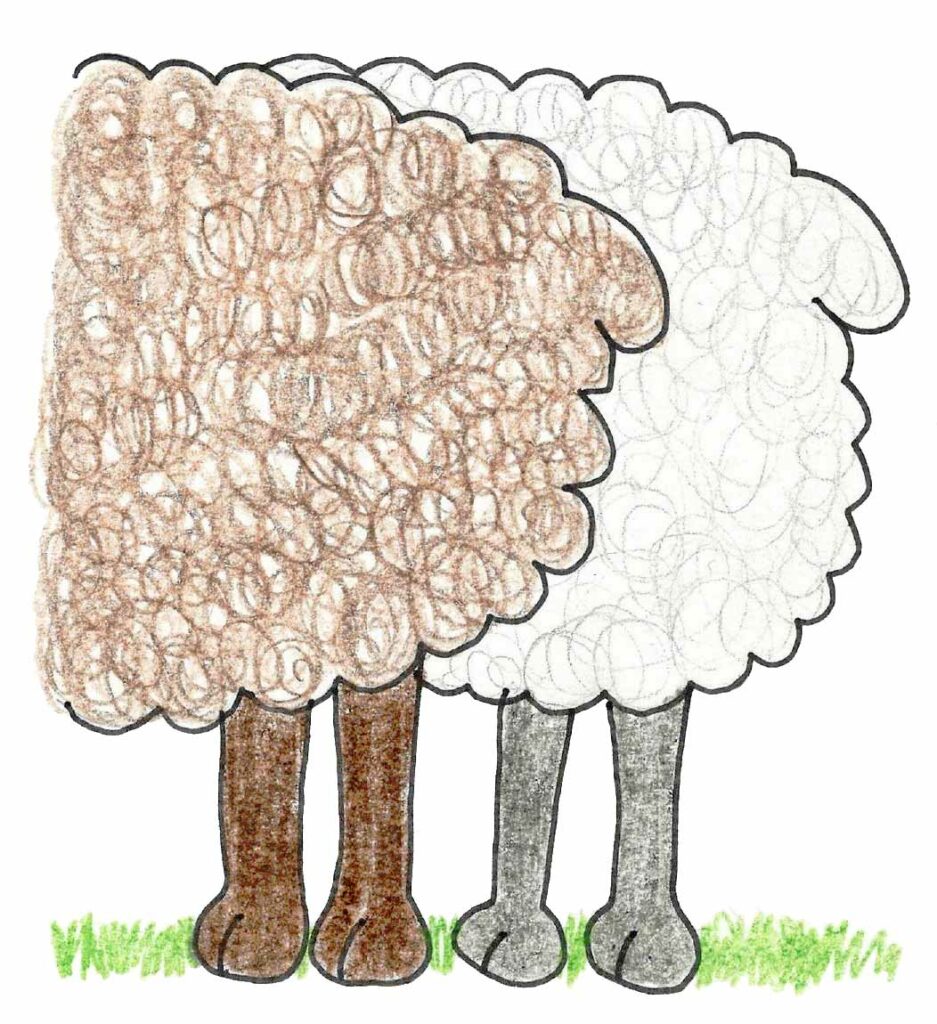
Das Taschengeld in dieser Form ist auch an sich ein Argument gegen eine Verpflichtung. Für ein Jahr mit so wenig Geld zu leben muss man sich leisten können. Bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres besteht zwar Anspruch auf Kindergeld und auch Wohngeld kann beantragt werden, aber die Lebenserhaltungskosten deckt das kaum. Ohne finanzielle Unterstützung durch die Eltern ist ein Jugendfreiwilligendienst kaum stemmbar.
Nun Menschen jeder ökonomischen Schicht in ein solches Lebensverhältnis zu zwingen, wäre nichts weiter als klassistischer Dreck – anders kann und will ich es gar nicht bezeichnen. Natürlich könnte man deshalb das Taschengeld erhöhen; was wiederum eine deutliche Mehrausgabe für einen Staat wäre, der ja jetzt schon kaum bereit ist, die bestehende Taschengelder an die aktuellen Lebenserhaltungskosten anzupassen. Aber klar: Wollen junge Menschen sich freiwillig engagieren, ist das nicht wichtig genug, um es ausreichend zu finanzieren – doch eine Verpflichtung wäre so toll, dass man bereit wäre, dafür sehr große Summen in die Hand zu nehmen.
Ausbaufähig
Wer möchte, dass sich mehr junge Leute gezielt ein Jahr lang gemeinnützig engagieren, sollte sie nicht zwingen, sondern das Engagement attraktiver gestalten. Wenn ich sage, ich bin Fan vom Jugendfreiwilligendienst, dann heißt das nicht, dass ich komplett zufrieden mit dessen gesellschaftlicher Konzeption bin; im Gegenteil.
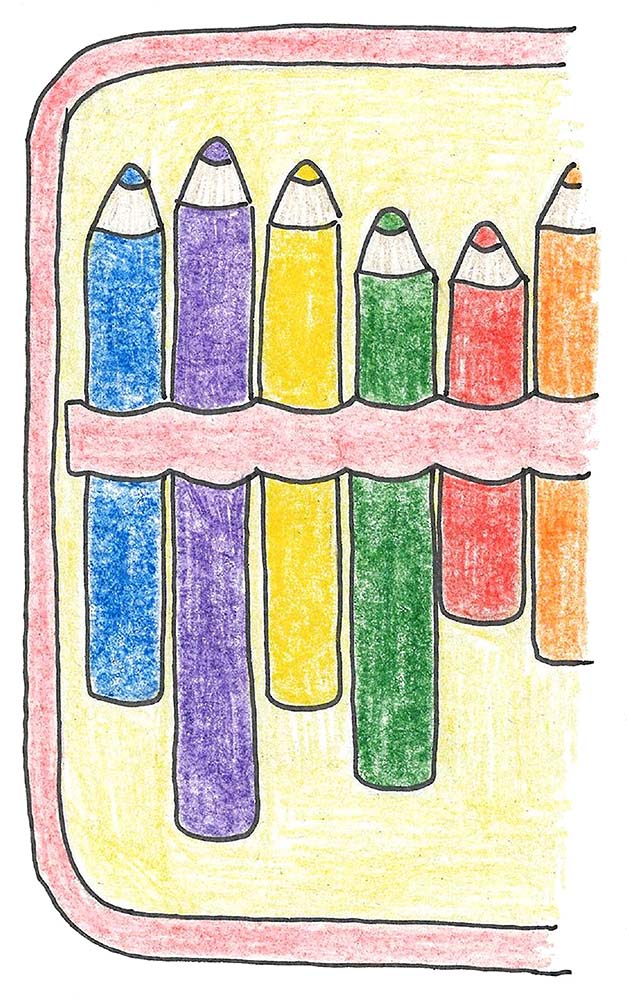
Oft wird Freiwilligendienst als eine Art Umweg im Lebenslauf angesehen, ein „Ich wusste halt nicht, was ich nach dem Abi machen sollte“ – meines Erachtens nach eine vollkommen legitime Situation –, das kaum Mehrwert für den weiteren Lebensweg besitzt. Erworbene Kompetenzen und inneres Wachstum werden später kaum gesehen oder erfragt.
Des Weiteren sei auf die Frage hingewiesen, wer überhaupt Zugang zu einem Freiwilligendienst hat. Im Kulturbereich mit seinen Einsatzstellen in Theatern und Museen fällt es besonders ins Auge: Hier sind kaum Freiwillige aus ärmeren Schichten vertreten. Das ergibt sich schlicht aus der klassistischen Grundstruktur der deutschen Gesellschaft. Doch ebenfalls zu Einsatzstellen wie Sportvereinen oder Naturschutzgebieten haben armutsbetroffene Kinder und Jugendliche zuvor oft keine direkte Verbindung. Es ist nicht nur das geringe Taschengeld, das ihnen diese Form der Teilhabe verwehrt.
Die Freiheit der Träger kann ebenso problematisch sein. Wie erwähnt ist ihr Job die Begleitung der Freiwilligen durch ihr Jahr. Dazu kommt die Gestaltung von sogenannten Bildungstagen. Gesetzlich sind im zwölfmonatigen Freiwilligendienst mindestens 25 Bildungstage vorgeschrieben. Ein Großteil davon wird in Form von Seminarfahrten absolviert, wo Freiwilligendienstleistende in Gruppen gemeinsam mit Mitarbeitenden ihres Trägers für eine knappe Woche gemeinsam verreisen.
Neben dem Austausch mit Mitfreiwilligen nehmen sie hier an Bildungsangeboten teil, die frei vom Träger gestaltet werden und deren Schwerpunkte sich an der Ausrichtung des Dienstes orientieren. Das schafft mehr Flexibilität in Struktur und Inhalt, als es das aktuelle Konzept staatlicher Schulen je könnte. Aber das wird nicht nennenswert geprüft. Gleiches gilt für die Begleitung der Freiwilligen in ihrem Arbeitsalltag. Der Träger spielt eine wichtige Rolle bei der Qualität des Freiwilligendienstes, seine Mitarbeitenden sollen die Ansprechpersonen sein bei Problemen, die im Laufe des Jahres auftreten – aber was tun, wenn tatsächlich der Träger das Problem ist? Diese Erfahrung müssen Freiwillige jedes Jahr aufs Neue machen. Nicht alle fühlen sich bei ihrem Träger und mit dessen Arbeit wohl. Also, welche Möglichkeiten hat der:die Freiwilligendienstleistende bei starker Unzufriedenheit? Er:sie kann sich an offizielle Vertreter:innen aus der Sozialpolitik wenden! Ich sage es mal so: Da ist noch viel Potenzial, das Ganze etwas niedrigschwelliger zu gestalten für die jungen Leute. Böse Zungen würden behaupten, eine so große Hürde sei nur ein weiterer Ausdruck politischer Ignoranz.
Hallo? Hört uns jemand?
Überhaupt ist das mit der Interessenvertretung von Freiwilligendienstleistenden so eine Sache. Kinder und junge Menschen haben eh kaum politisches und gesellschaftliches Mitsprache- und Gestaltungsrecht. Der Freiwilligendienst selbst fällt bei verantwortlichen Politiker:innen im Sozialbereich neben all den „größeren“ Themen wie Schule oft hinter die Bank.
Einige Träger wie etwa der Dachverband Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V. und seine Ableger in den einzelnen Bundesländern haben sich selbst zur Einrichtung einer Freiwilligenvertretung verpflichtet. Es ist ein Ehrenamt, das Freiwillige zusätzlich zu ihrer Arbeit in der Einsatzstelle annehmen können, um sich für die Belange von Jugendfreiwilligendienstleistenden einzusetzen. Ein Beispiel dafür ist die Aktion #freiefahrtfuerfreiwillige, mit der eine kostenlose Nutzung des ÖPNVs für Freiwillige gefordert wird. Die 58 Euro für das Deutschlandticket sind schlicht ein zu hoher Kostenpunkt im geringen Taschengeld, zumal viele Freiwillige auf die Öffis angewiesen sind, um zu ihrer Arbeit zu gelangen. Die Freiwilligenvertretung ist der Versuch nachhaltiger Lobbyarbeit, die auch immer mal Früchte trägt, aber wie gesagt: Gehört wird die Gruppe der Freiwilligen selten und die zusätzliche Arbeit mit der Begleitung einer Freiwilligenvertretung machen sich auch nicht alle Träger.

Die immanente Fluktuation des Freiwilligendienstes ist auch ein Hindernis für ein kontinuierliches Wirken auf die Politik. Wenn in jedem Jahr neue Menschen kommen – für die auch noch der Einstieg in den Freiwilligendienst und die neue Lebensphase mitunter recht stressig und fordernd ist –, wird eine konstante Arbeit zur nachhaltigen Verbesserung deutlich erschwert. Träger engagieren sich ebenfalls dahingehend, aber dies reicht nicht aus. Die Stimmen von „Betroffenen“, also von Freiwilligen, sind ein unabdingbarer Aspekt der Arbeit.
Und: „Es ist nur für ein Jahr.“ – Ich vermute, dass das auch viele von einem stärkeren Engagement abhält. Wer sich während seines:ihres Freiwilligendienstes für Veränderungen stark macht, arbeitet dabei in erster Linie für kommende Jahrgänge, nicht für sich selbst.
Also alles recht hoffnungslos? Nicht ganz! Im April 2023 riefen Sprecher:innen verschiedener Freiwilligenvertretungen die Kampagne „Freiwilligendienste stärken“ ins Leben. Mithilfe einer Petition wollten sie für Verbesserungen werben; genau im Petitionszeitraum wurde jener Bundeshaushaltsentwurf vorgelegt, der für 2024 die Kürzungen in Höhe von 78 Millionen Euro vorsah. Ad hoc verlegten die Aktivist:innen den Schwerpunkt der Petition auf die finanzielle Sicherung des Freiwilligendienstes. Das Quorum lag bei 50 000 Unterschriften, am Ende konnten sie über 100 000 sammeln. Es war jene Petition, die die Kürzungen im Bundeshaushalt zunächst verhinderte.
Eine kurze Zeichenstunde
Veränderungen durch Engagement sind spürbar – und nichts zeigt das so schön wie der Jugendfreiwilligendienst. Ich habe am Anfang geschrieben, ich sei Fan, aber ich habe noch gar nicht erklärt, warum. Es liegt vor allem an dem inneren Wachstum, das in diesem Jahr passiert; und das ist gewaltig.
Da sind erst einmal junge Leute, die bisher einen Großteil ihres Lebens in der Schule verbracht haben. Das Ziel dort: den Menschen, der vor der Klasse steht, zufriedenstellen. Du gibst wieder, was dieser Mensch hören will, und bekommst dafür eine Bewertung deiner Leistung. Was du erarbeitest, wird dir vorgegeben: die Form, der Inhalt, das Tempo, alles bestimmt durch ein Bildungsministerium, repräsentiert durch die Lehrkraft. Am Ende bekommst du ein Blatt Papier, wo in Form von ein paar Ziffern zu lesen ist, wie gut du diese Vorgaben in den letzten Monaten und Jahren erfüllen konntest. Dabei hast du nur für dich selbst gearbeitet, für dieses Blatt Papier. Es ist ein unpersönliches System, das allen gleiche Ergebnisse abverlangt, und parallel dazu egoistisch, weil es den Fokus allein auf die eigenen Leistungen lenkt.
Dann sitzen diese jungen Menschen plötzlich in ein Team. Hier hat jeder Mensch andere Aufgaben, alle arbeiten spezialisiert nach Fähigkeiten, aber auf ein gemeinsames Ziel hin. Für Freiwillige ist es eine Zeit, in der sie längerfristig ihre Talente und Interessen erkunden, schulen und ausleben können. Sie übernehmen Verantwortung – und zwar nicht für ihr Blatt Papier am Ende der Schullaufbahn, sondern eben für Patient:innen oder die Theatervorführung. Viele machen hier die Erfahrung, wie es ist, an einem wirklich fassbaren Ziel zu arbeiten. Sie werden Teamplayer:innen. Sie lernen, wie die Branche funktioniert, in der sie sich bewegen, und was Arbeit bedeutet. Sie treffen neue Menschen, vor allem auch einmal außerhalb ihrer Altersgruppe. Sie geben Input. Ihre Ideen und Fähigkeiten bewirken Veränderungen in der Einrichtung. Sie erleben das Gefühl von Selbstwirksamkeit – ich kann nicht genug betonen, wie wichtig das für eine demokratische Gesellschaft ist.
Natürlich zeichne ich damit ein Idealbild. Nicht jede Einsatzstelle ist gleich, nicht jede:r Freiwillige macht diese Erfahrungen. Aber ein Jugendfreiwilligendienst ist in seiner Struktur so anders als alles, was die meisten jungen Menschen kennen, dass es nahezu unmöglich ist, dort keine neuen Erfahrungswerte zu sammeln. Das sind Dinge, die ich an mir beobachten konnte und vor allem jetzt immer wieder an den Freiwilligen sehe, die ich begleiten darf.
Auf Augenhöhe
Sie kommen aus einer bewegten Phase in ihrem Leben. In der Pubertät passiert so vieles, das den Charakter eines Individuums prägt und formt. Der Freiwilligendienst ist eine Möglichkeit, als nun „halbwegs fertiger“ und erwachsener Mensch in die Welt hinauszutreten und zu schauen, wie diese reagiert. Mehr als einmal schilderten mir Leute am Ende eines Jahrgangs, wie sehr sie in den letzten Monaten aufgeblüht seien, nachdem sie in der Schule immer die schüchterne Maus waren. Selbst wenn sie schon in der Oberstufe das Gefühl hatten, dass diese Rolle längst nicht mehr zu ihnen passte, wurden sie nach Jahren in den immer gleichen Sozialstrukturen weiterhin entsprechend behandelt.
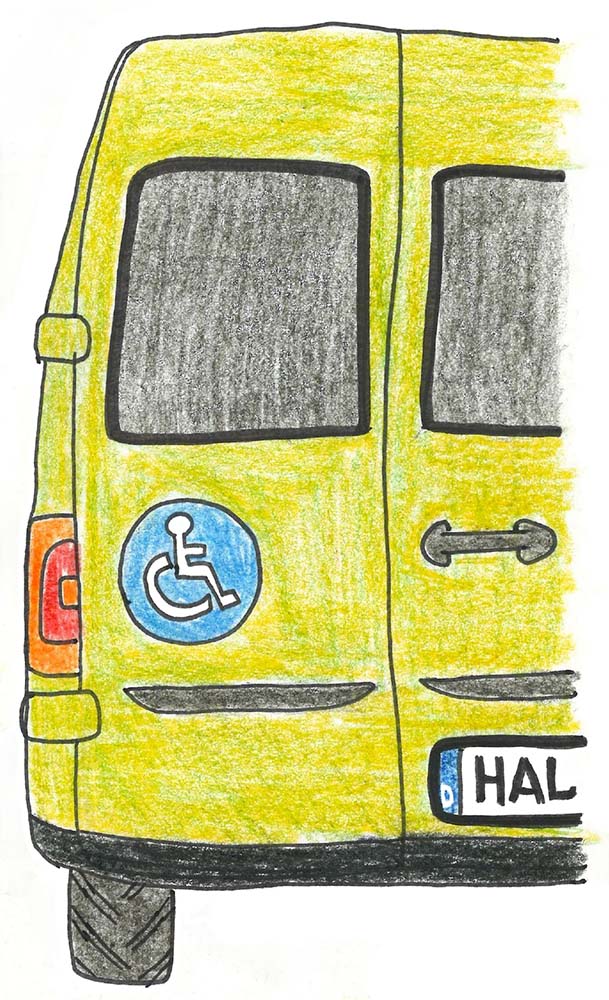
Der Freiwilligendienst ist eine tolle Chance, aus alten Mustern auszubrechen; nicht nur auf Arbeit, sondern auch auf Seminaren. Das dortige Vernetzen mit Gleichaltrigen, die gerade ähnliche Erfahrungen machen, kann sehr nachhaltig sein. Neben Kooperationen zwischen verschiedenen Freiwilligen und ihren Einsatzstellen ergeben sich da nicht selten langjährige Freundschaften oder Liebesbeziehungen.
Viele prägt auch die Erfahrung einer grundsätzlich anderen Pädagogik als die, die sie aus der Schule kennen. Ich will hier nicht die Arbeit aller Lehrkräfte durch den Schmutz ziehen – im Gegenteil, ich ziehe meinen Hut vor jedem Menschen, der sich in diesem Bildungssystem vor eine Klasse stellt und den zermürbenden Strukturen zum Trotz versucht, empathisch und pädagogisch zu wirken. Doch eines der häufigsten Feedbacks, das wir als Teamer:innen auf den Seminaren bekommen, ist die Überraschung und Dankbarkeit ob der Tatsache, dass wir den Freiwilligen auf Augenhöhe begegnen. Meine bewegendsten Momente auf Arbeit waren alle in irgendeiner Weise daran geknüpft. Da sitzt eine 18-Jährige abends mit dir zusammen und lässt quasi am Rande fallen, dass deine Kollegin heute die erste pädagogische Instanz war, die sie je gefragt hatte, was sie eigentlich brauche. Alle vorher hatten sie schlicht als Störenfried abgetan, der entweder die Klappe zu halten habe oder den Raum verlassen solle.
Es macht etwas mit diesen jungen Menschen, wenn man auf sie eingeht. Wenn man ihnen erklärt, warum man bestimmte Regeln aufstellt und welche Dinge man von ihnen einfordert, damit die gemeinsame Zeit auch gut wird. Gerade was diesen Aspekt angeht, kann ich in erster Linie nur für den Träger sprechen, bei dem ich arbeite und auch mein eigenes FSJ gemacht habe, aber ich merke: Wir haben da eine Wirkung. Eine sehr positive. Wie mein Kollege Norman es ausdrückte: „Das hören wir ja öfter: ‚Ihr begegnet uns hier auf Augenhöhe, das ist neu für uns und das finden wir gut.‘ Das sind diese Kleinigkeiten, diese gesellschaftlichen Stellschrauben, durch die man jungen Menschen begegnen kann und was sie stärker und selbstbewusster macht.“
Ein bescheidener Vorschlag
„Also vielleicht doch eine Pflicht? Du sagst doch selbst, was für eine Bereicherung das Jahr für die jungen Menschen sei!“ Ja, aber ich will noch einmal betonen: Der Wert des Ganzen liegt in der Freiwilligkeit.
Überhaupt, warum wird immer nur darüber geredet, was für ein Erfahrungsgewinn es für die Dienstleistenden ist? Was ist mit den Kolleg:innen in den Einrichtungen? Was mit den Menschen, die von der Arbeit der Einsatzstellen profitieren wie Gedenkstättenbesucher:innen oder Kindergartenkinder? Der Diskussion um diese Form des sozialen Engagements – sei es nun freiwillig oder verpflichtend – wohnt stets ein starker Adultismus inne. Ganz so, als hätten junge Menschen nichts zu geben außer ihrer Zeit. Da fehlt jede Wertschätzung für die Energie und Ideen, mit denen junge Leute diese Gesellschaft positiv prägen können und wie es ja auch immer wieder geschieht. Zumal viele Einsatzstellen, auch wenn das nicht so sein sollte, längst auf die Dienstleistenden angewiesen sind, um über die Runden zu kommen. Die soziale, kulturelle und auch ökologische Branche sind chronisch unterfinanziert. Machen wir uns nichts vor: Ohne das Engagement dieser jungen Leute würde da vieles zusammenbrechen.
Aber nein, die arbeitsfaule Gen Z kennt ja nur Smartphone und TikTok! Also erstens ist Medienkompetenz eine äußerst wichtige Fähigkeit in der heutigen Zeit, bezüglich derer sehr viele Einrichtungen von ihren Freiwilligen lernen können, und zweitens ist das ein schlicht blödsinniges Klischee! Jungen Menschen wird nur viel zu wenig vertraut. Gerade eine Umgebung wie eine selbstgewählte Einsatzstelle kann da großartige Dinge herauskitzeln. Ein sozialer Dienst ist keine Einbahnstraße, die verschiedenen Parteien befruchten sich hier gegenseitig.
Doch schwingt der Adultismus weiter mit in der Forderung, junge Leute sollten prinzipiell eine bestimmte Zeitspanne ihres Lebens „zum Dienste an der Gesellschaft“ hergeben. Es sind stets die Jungen, von denen so etwas verlangt wird; auch weil es die Leute, die es fordern, nicht mehr betrifft.
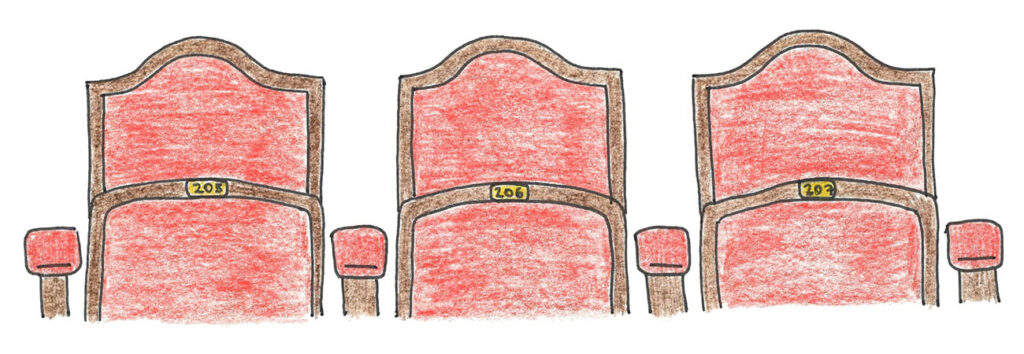
Gegenvorschlag: Soziales Übergangsjahr zwischen Beruf und Rente! Wenn ihr glaubt, junge, unerfahrene Menschen seien eine Hilfe, was meint ihr, wie großartig es erst wird, wenn diese Aufgabe Ältere mit Erfahrung übernehmen. Zumal es viel mehr von ihnen gibt! Die Boomer:innen-Generation hat die geburtenstärksten Jahrgänge und sie sind gerade auf dem Weg zum Renteneintritt. Da hat die Oma im Altersheim gleich zwei Halma-Partner:innen! Wäre das außerdem nicht ein guter Ansatz, um Einsamkeit im Alter entgegenzuwirken? Ein großes Problem, wie wir wissen. Wir binden systematisch ältere Menschen noch einmal aktiv in die Gesellschaft ein und wer weiß – vielleicht gefällt es ja dem ehemaligen Bauleiter Jürgen in der Stadtbibliothek so sehr, dass er auch als Rentner weiterhin mittwochs die Kinderleserunde anbietet.
Warte – nicht so cool? Beträfe dann ja plötzlich viel mehr Leute, dieses „geklaute Jahr“; auch die Entscheidungsträger:innen dieses Landes. Zugleich lässt es sich nicht so hübsch mit unserem Militarismus vereinbaren. Mit 67 dauert es ziemlich lange, ehe man die Tarnfarbe aus allen Falten geschrubbt hat.
Eine Frage der Schuld(en)
Außerdem könnte man sich dann nicht mehr auf mein Lieblingsargument für einen Pflichtdienst stützen: Die jungen Leute sollen der Gesellschaft etwas zurückgeben! Im Wesentlichen heißt das: Alle Menschen sind nach Schulaustritt erst einmal Schuldner und haben jetzt diese Schuld ihrem Gläubiger gegenüber – der Gesellschaft – abzutragen. Ich persönlich kann mich nicht erinnern, einen solchen Vertrag unterschrieben zu haben. Auch ist das der gleiche Vater des Gedankens, aus dem heraus Verachtung für Gruppen wie etwa Erwerbslose, Schwerbehinderte oder Asylbewerber:innen ohne Arbeitserlaubnis gedeiht. Die leben „auf Kosten anderer“ und „tragen selbst nichts bei“. Sie gelten als Belastung. Solche Denk- und Handlungsstrukturen sind sehr weit weg von der Solidargemeinschaft, die ich mir wünsche.
Zudem frage ich mich, welche Schulden wir Jungen denn nun genau bei den Älteren haben sollen. Ihr zwingt uns durch ein Schulsystem, von dem Expert:innen verschiedenster Fachrichtungen seit Jahrzehnten fordern, es von Grund auf zu reformieren, weil es junge Menschen mehr kaputtmacht als beflügelt. Dafür sitzen wir in viel zu großen Klassen in renovierungsbedürftigen Gebäuden vor einer Lehrkraft, die völlig ausgebrannt ist, weil sie alle Physikstunden einer gesamten Schule abdecken muss. Es fehlt an Kolleg:innen. An Schulsozialarbeiter:innen und ‑psycholog:innen sowieso. Nebenbei wächst jede:r Fünfte von uns armutsgefährdet auf. Die werden dann in der Regel nach der vierten Klasse schön segregiert, damit sie ja keine Aufstiegschancen bekommen. Ohne Abi wird man ja nichts. Wer von uns Abi machen darf, weiß aber jetzt schon, dass es immer weniger Unistädte gibt, wo er:sie sich überhaupt ein WG-Zimmer leisten könnte. Unsere Generation ist so queer und migrantisch geprägt wie keine zuvor und wir müssen uns anhören, wie angebliche Mitte-Politiker:innen – und mit ihnen eine ganze Gesellschaft – immer aggressiver und empathiebefreiter darüber diskutieren, welche Existenzberechtigung wir überhaupt noch haben. Quasi nebenher zerlegen sie dabei kontinuierlich und effektiv unsere Demokratie, von der sie selbst so lange profitieren durften. Was in Anbetracht der heranrasenden Klimakatastrophe inzwischen ein fast zu vernachlässigendes Problem ist. Alt werden wir eh nicht. Und um nichts davon haben wir gebeten.
Es sind die Älteren, die uns etwas schulden – nämlich uns ernst zu nehmen. Wir sind nicht euer Wundermittel, um verzweifelt die riesigen Lücken zu stopfen, die eine jahrzehntelange Vernachlässigung der Sozialpolitik hinterlassen hat. Wir sind nicht euer Sündenbock, um die Schuld an fehlendem sozialen Zusammenhalt zu buckeln. Ihr weigert euch, Geld in die Hand zu nehmen, um Kultur, Nachhaltigkeit und soziale Netze – die wichtigsten Grundpfeiler für eine gesunde Demokratie und Gemeinschaft – zu fördern und zu schützen. Ihr wollt die FSJ-Stelle in dem kleinen Kunstverein auf dem Dorf nicht weiter finanzieren, aber ihr wollt auch, dass … ihr jemanden von uns zwingen könnt, dort zu arbeiten?
Wie viel Wert hat gesellschaftliches Engagement noch mal genau?
Text und Illustrationen: Ronja Hähnlein

Toller artikel! Viele spannende neue infos und gedanken. Liebe Grüße