Anschläge wie jener in Halle vom 9. Oktober sind einschneidende Ereignisse: Sie verunsichern, stellen das gemeinsame Zusammenleben in Frage. Die psychische Verarbeitung ist oft schwierig, aber machbar. Was so ein Ereignis auslösen kann – aber nicht muss.
Dieser Artikel erschien in
Heft 87 (Januar 2020)
In der Humboldtstraße flattern in diesem Winter bunte Wimpel über der Straße. Ausgeschnittene dreieckige Schnipsel, die von Haus zu Haus oder zur nächsten Straßenlaterne gespannt sind. Die Bewohner:innen wollen zeigen, dass das Bekenntnis zur Vielfalt stärker ist als der rechtsextreme Terror, der am 9. Oktober plötzlich und unvorhergesehen über das Paulusviertel hereinbrach. Gemeinsam aussprechen, wofür man steht, dieses Bedürfnis verspürten viele Hallenser:innen in den Tagen und Wochen danach – eine Reaktion, die nicht nur eine politische Aussage ist, sondern auch ein Bedürfnis zeigt, die Verunsicherung gemeinsam zu verarbeiten. Doch woher kommt dieser Drang, nach dem Attentat selbst zu handeln?

Wie Menschen mit einem verstörenden Ereignis umgehen und es verarbeiten, ist ganz unterschiedlich. Zum einen sind da die Bürger:innen der Stadt, die den Anschlag mehr oder weniger nah erlebten. Für manch einen von ihnen ist der Alltag schnell wieder zurück, bei anderen hält das mulmige Gefühl noch eine Weile an. Direkt Betroffene, wie Augenzeugen und Angehörige der Opfer, können hingegen viel gravierenderen psychischen Folgen ausgesetzt sein.
Medizinischer Trauma-Begriff deutlich enger
Häufig fällt in diesem Zusammenhang das Wort traumatisch; zum einen, um das Ereignis für die direkt Betroffenen zu beschreiben, oft aber auch um die Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft zu bezeichnen. Im medizinischen Sinne völlig korrekt ist letztere Bezeichnung allerdings nicht. „Nach den Kriterien der wissenschaftlichen Klassifikationssysteme kann ein Trauma nur bei direkter Beteiligung am Geschehen oder einer unmittelbaren Verbindung zu einer beteiligten Person vorliegen“, erklärt Dr. Utz Ullmann, Leiter der medizinischen Psychologie am Bergmannstrost Klinikum in Halle. Zwar sei nach dem Attentat bei vielen Hallenser:innen eine allgemeine Verunsicherung durchaus spürbar gewesen, allerdings könne man dabei nicht von einem Trauma sprechen. Prof. Dr. Bernd Leplow, Professor für Psychologie an der MLU, erkennt aber an, dass „für eine Gesellschaft, die sich an demokratische, rechtsstaatliche Verhältnisse gewöhnt hat, so etwas in einem kulturellen Sinne traumatisch sein kann.”
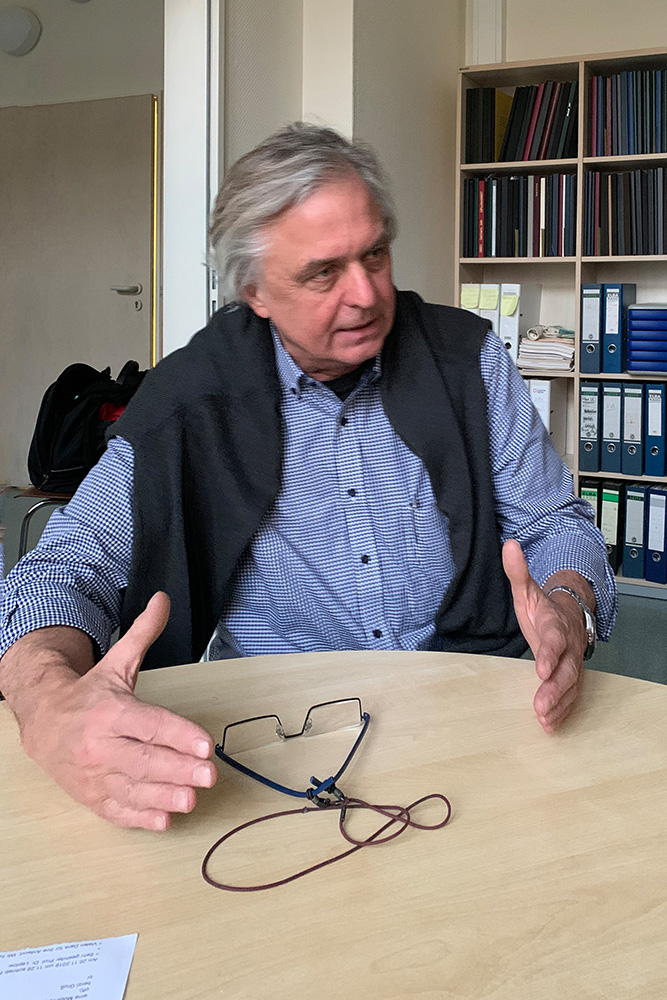
Foto: Jonas Kyora
Ein Trauma im wissenschaftlichen Sinn ist außerdem weniger ein psychischer Zustand als vielmehr ein Ereignis. Es wird ausgelöst, wenn Menschen in absolut außergewöhnliche Situationen versetzt werden. „Zentraler Moment einer Traumasituation ist der Kontrollverlust, verbunden mit einem Gefühl der persönlichen Bedrohung”, erklärt Ullmann das Geschehen. „Häufig wird dann eine Schockreaktion ausgelöst“, so Ullmann weiter. Wichtig zu verstehen sei aber, dass hierbei „eine normale Reaktion auf eine unnormale Situation erfolgt“. Auf Grund der absoluten Unnormalität des Ereignisses könnten Aufgeregtheit, Orientierungslosigkeit und Erinnerungslücken mögliche Folgen sein. Erst wenn diese Symptome längere Zeit anhalten und nicht durch eigene Verarbeitungsstrategien eingedämmt werden können, spricht man von einem pathologischen, also krankhaften Zustand, bei dem die Betroffenen professionelle Hilfe brauchen.
Es hilft zu handeln
Zunächst werden nämlich bei allen – sowohl bei direkt Beteiligten als auch bei indirekt Betroffenen – die Bewältigungsmechanismen abgerufen, die beim Menschen automatisch in Krisensituationen aktiviert werden: Allgemein „braucht man genügend Handlungskompetenz, um irgendetwas zu tun, um seine Stabilität zurückzugewinnen“, führt Ullmann aus. Auch Prof. Leplow betont, wie wichtig es ist, nach traumatischen Ereignissen die „sonst frei fließenden Gefühle” in Handlungen zu kanalisieren. „Ansonsten bleibt im Gehirn ein Stressor aktiv.” Als Stressor bezeichnet man in der Psychologie einen Impuls, der den Menschen darauf vorbereitet zu handeln. In traumatischen Situationen, erklärt Leplow, komme es zu einer gravierenden Aktivierung von Stressoren, die ohne verarbeitende Handlungen nach dem Ereignis fortbestehen. Aber auch die Unmöglichkeit, selbst zu handeln, sei für sich genommen bereits ein Stressor.
Oftmals, so Ullmann, helfe es, sich in solchen Situationen beispielsweise mit Freunden und Bekannten auszutauschen. Manche würden im Garten arbeiten oder Musik hören. Was jedem dabei am meisten hilft, hänge sehr von der individuellen Persönlichkeit ab. Bei einer so massiven Belastung wie nach einem Terroranschlag könne es passieren, „dass man danach wie betäubt ist, man kann also diese Bewältigungsmechanismen gar nicht abrufen.“ Die Hilfe, die dann von ausgebildeten Therapeuten und Seelsorgern geleistet wird, „beginnt mit ganz kleinen Dingen“, erklärt Ullmann. „Man fragt den Patienten zum Beispiel zu Beginn, auf welchem Stuhl er sitzen möchte, um ihm so immer mehr die Kontrolle zurückzugeben.“ Außerdem werden die meisten Patienten:innen zunächst abgeschottet. Sie sollen geschützt werden, um sich regenerieren zu können und nicht durch Konfrontationen mit den Ereignissen in Gesellschaft, Presse und sozialen Medien „sekundär traumatisiert“ zu werden.
Rituale geben Gemeinschaftsgefühl
Nichtsdestotrotz sei die öffentliche Reaktion auf den Anschlag ebenso verständlich. Das Konzert auf dem Marktplatz zehn Tage später, die Trauermärsche und die Kundgebungen vor der Synagoge der jüdischen Gemeinde Halles seien deshalb eine normale Reaktion gewesen. „Auch wenn für den betroffenen Einzelnen die gezielte individuelle therapeutische Dimension wichtiger ist, sind Rituale für die Stadt als solche wichtig“, schätzt Ullmann ein. Auch Leplow ist der Meinung, Rituale seien für Menschen eine Möglichkeit, ihre Erfahrungen zu kanalisieren, was dem Stressor des Nichthandelnkönnens entgegenwirken könne. Diejenigen, die sich durch diese Bekundungen nicht angesprochen gefühlt haben, sind laut Ullmann nicht weniger normal, im Gegenteil: “Sie haben dann genügend Bewältigungsressourcen, um die Geschehnisse allein zu verarbeiten.”

Foto: Jonas Kyora
Nicht ganz unproblematisch sind allerdings die Besuche zahlreicher Politiker:innen im Anschluss an den Anschlag. Während Bundespräsident Steinmeier und Innenminister Seehofer vergleichsweise unaufgeregt am Tag danach die Synagoge besuchen und ihr Mitgefühl aussprechen, sorgt der Kurzbesuch des US-amerikanischen Außenministers Mike Pompeo vier Wochen später für erheblichen Wirbel: Hubschrauber der Polizei kreisen über dem Norden der Stadt, die Ludwig-Wucherer-Straße ist abgesperrt, das Paulusviertel wird wieder zur Hochsicherheitszone. Zwar könne die ausgedrückte Wertschätzung durch die Besuche und Anteilsbekundungen durchaus für das Stadtkollektiv sinnvoll sein, „für einzelne Betroffene kann darin allerdings wieder eine gewisse Reinszenierung eines Ausnahmezustandes liegen”, gibt Ullmann zu bedenken. Letztendlich müsse man immer diese zwei Seiten sehen.
Als das Jahr 2019 zu Ende geht, ist im hallischen Alltag vom Anschlag nicht mehr viel zu spüren. Für die Stadtbevölkerung scheint eine Rückkehr zur Normalität möglich. Prof. Leplow führt dies auch darauf zurück, dass die Verarbeitung in der Stadt gut funktioniert hat. „Danach ist man dann zur Normalität übergegangen. Das ist meiner Einschätzung nach auch richtig, denn man täte ja dem Täter einen großen Gefallen, wenn das städtische Gleichgewicht zerstört worden wäre.“ Und Dr. Ullmann lobt den Zusammenhalt, der während der Verarbeitung zu spüren gewesen sei: „Das zeigt, dass, so unterschiedlich die Lebenseinstellungen der Menschen auch sind, man doch Hoffnung haben kann, dass sich in schwierigen Krisensituationen gegenseitig unterstützt wird und jeder auf andere Menschen zählen kann.”
- This article is also available in English: https://hastuzeit.de/the-good-about-normality/
Text: Jonas Kyora
Recherche: Anja Thomas, Pauline Franz, Jonas Kyora
