Geschlechtergerechte Sprache ist eine Herausforderung, manchmal eine Überwindung. Aber sie ist unbestreitbar wichtig. Wir haben jetzt auch damit angefangen, es einheitlich zu machen. Aus der Flut der möglichen Zeichen haben wir uns den Doppelpunkt ausgesucht. Ein sehr persönlicher Brief über die Tücken einer sich wandelnden Sprache.
Liebe Leser:innen,
kurz nachdem ich „Leser“ tippe, erstarrt mein rechter Zeigefinger verunsichert über der Tastatur meines Laptops. Fast automatisch zuckt er nach oben rechts – hin zum Stern. Nicht Sternchen, Gendern ist keine zu verniedlichende Angelegenheit. Dann, nach diesem kurzen Schwenk, erinnert sich mein Finger und schnellt fast ruckartig zurück nach unten – hin zum Doppelpunkt.
Ich unterwerfe mich noch etwas ungelenk dieser Schreibweise. Der Doppelpunkt überrascht. Nicht weil wir jetzt gendern, sondern weil er vielleicht nicht die gewöhnlichste aller Arten der gerechten Sprache ist.
Gendern ist nicht einfach. Gendern wird auch nicht immer konsequent angewandt. Manch einer stolpert über einen unerkannten Handwerker, nimmt sich dann aber umso mehr Zeit für die Französinnen und Franzosen, die sich nur schwer in einem Wort vereinen lassen. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig. Das möchte ich dahinstellen – als gegeben. Wer sich zu Hause am Küchentisch noch darüber streiten muss, dem spreche ich mein herzliches Beileid aus.
Wir, die hastuzeit, haben uns seit der letzten Ausgabe auf eine Form zu gendern geeinigt, nämlich auf den Doppelpunkt. Und wer diesen nicht verwenden möchte, der muss sich eine zeichenlose Variante des Genderns aussuchen oder schreibt dann eben geschlechterungerecht. Doppelpunkt oder kein Doppelpunkt, vor dieser Frage steht ab sofort jede:r Autor:in. Es gab viele andere Möglichkeiten. Um die soll es nun auch gehen.

Zuerst möchte ich die vermeintlich einfachste Form vorstellen. Die Paarform. Eigentlich ein Gewinn. Sie ist sprachlich korrekt, man merkt, dass der Sprecher oder die Sprecherin sich Zeit nimmt, um Sprache gerecht zu machen. Es gibt nur zwei Probleme. Ihre Stärke, das Sich-Zeit-Nehmen, ist auch ihre Schwäche. Jeder muss selbst wissen, ob er die Zeit hat; oft geht die Anrede dann aber in einem unverständlichen Genuschel unter. Ich habe schon oft genug Menschen „Professoren und Professoren“ sagen hören. Länge ist nicht nur beim Sprechen manchmal hinderlich, auch beim Schreiben. Und man denke nur an den Tintenverbrauch und die hohen Druckerpatronenkosten. Ein Alptraum, nicht nur für Schwaben.
Nicht zu vergessen, die Paarform liefert nicht, was sie vermeintlich zu versprechen scheint. Sie verbindet zwar Mann und Frau, aber sie schafft es nicht, an alles dazwischen und daneben zu denken. So bleibt das dritte Geschlecht zum Beispiel vollkommen unberücksichtigt. Also vergessen wir sie ganz schnell wieder, die Paarform.
Kommen wir lieber zum Binnen‑I oder zum Schrägstrich. Beide mit ähnlichen Nachteilen behaftet. Nicht nur, dass sie zu unglaublich umständlichen Satz- und Denkstrukturen führen können („Bist du der/die einzige Bäcker/in unter deinen Freund/innen?“), sie stellen uns vor die grammatikalische Sisyphusarbeit, „Arzt“ zu gendern. „ÄrztIn“ geht ja nicht, weil „Arzt“ nicht mit „Ä“, aber „ArztIn“ ja auch nicht, weil „Ärztin“ nicht mit „A“. Außerdem werden wieder nur Mann und Frau mitgedacht.

Dann gibt es noch die genderneutrale Methode: In manchen Fällen das Partizip („Studierende“), in anderen Fällen einfach ein von sich aus geschlechtergerechtes Wort („Menschen“). Mit dem Partizip ist es so eine Sache. Es vermag die konservative Kundschaft nicht zu verärgern, manche klammern sich aber an den grammatikalischen Strohhalm, springen auf die Barrikaden und schreien, dass Studierende ja wohl nicht immer studieren, sondern manchmal (wahrscheinlich sogar meistens) mit anderem beschäftigt seien. Oft wohl mit Alkohol, in dem Fall wäre dann „Suffköpfe“ wohl am gerechtesten. Wenn wir solche Menschen aber ignorieren, stoßen wir auf ein altbekanntes Problem. Unsere alten Feinde, die Ärzte und Ärztinnen und alle mit gleichem Berufsbild, aber anderer Geschlechtsidentität, stellen uns auch beim Partizip ein Bein. „Ärz-tende“ gibt es nicht, die „Ärzteschaft“ ist nicht gendergerecht, und die „Verarztenden” implizieren eine konkrete Aktivität. Einfach eine doofe Berufsgruppe.
Wie wäre es zur Abwechslung mit dem generischen Femininum? Statt also immer einfallslos die „Ärzte“ zu sagen, machen wir eine 180-Grad-Wende und sagen ab heute nur noch die „Ärztinnen“. Das ist provokant, macht auf die Problematik aufmerksam, es ist erfrischend und neu. Ein Problem bleibt aber, gerecht wird Sprache dadurch nicht.
Jetzt, schon sehnsüchtig erwartet, kommen wir zur wohl berühmtesten Form des Genderns – der Gender Gap. Sie kommt meistens als Stern daher, aber auch gerne als Unterstrich, Leerzeichen, Punkt oder Doppelpunkt. Jede Art hat ihre individuellen Vor- und Nachteile. Der Doppelpunkt ist schlank und fällt nicht auf, wenn man denn nicht auffallen will. Das war wohl das entscheidende Argument für die hastuzeit, ein weniger holpriger Lesefluss.
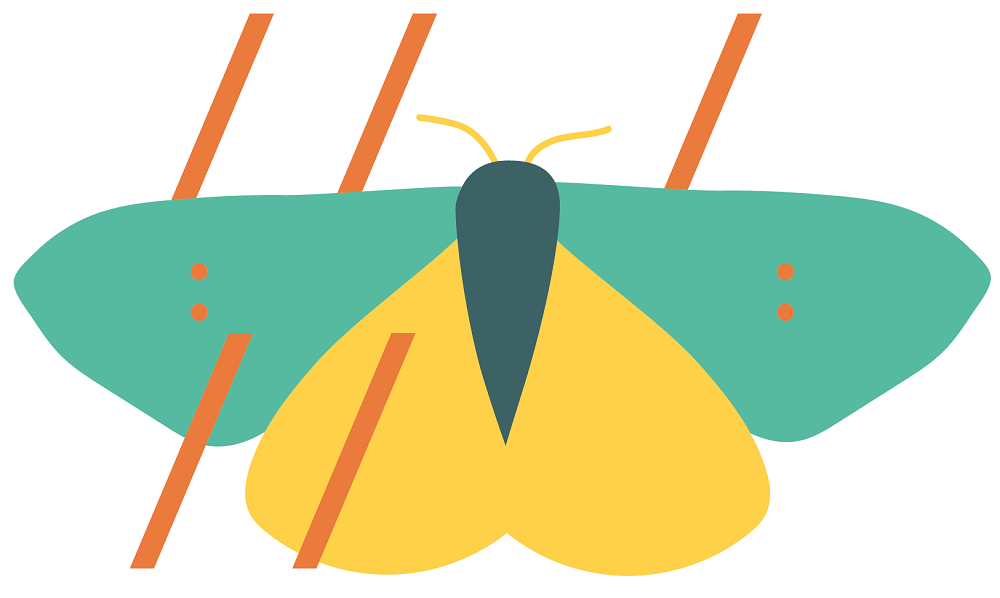
Der Stern ist populär. Das Leerzeichen aber macht aus einem zwei Wörter. Die Gender Gap hat jedenfalls einen unschlagbaren Vorteil: Sie nimmt alle mit. Ob es die Zacken des Sterns sind oder der Unterstrich, auf dem sich alle versammeln können, die Gender Gap denkt auch Menschen zwischen Mann und Frau mit. Es wäre aber nicht Gendern, wenn nicht auch hier Kritik laut würde. Grammatikalisch ist diese Art oft falsch, und bei Einzelpersonen stoßen wir auf ähnliche Probleme wie beim Binnen‑I, insbesondere bei der:dem Ärztin:Arzt. Soll das so aussehen?
Es gibt keine absolut richtige Art zu gendern. Jede hat ihre Vor- und Nachteile. Der Doppelpunkt, für den wir uns entschieden haben, ist nicht zwingend besser oder schlechter als die anderen Alternativen. Man muss sich selbst aussuchen, welche man am besten, am angenehmsten oder am anstößigsten findet. Es ist wichtig, sich zu streiten, über Doppelpunkt oder Binnen‑I, über Unterstrich oder Partizip. Denn wie wir sprechen, so denken wir. Unsere Sprache bestimmt, wie wir leben, und sie entwickelt sich immer fort. Sprachwandel gibt es, Sprachzerfall nicht. So wird es irgendwann völlig normal sein, geschlechtergerecht zu sprechen.
