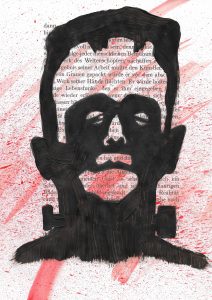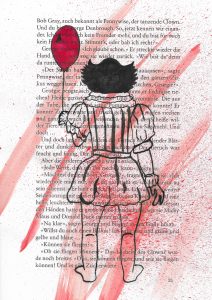Schauerliche Geschichten haben eine seltsame Anziehungskraft. Ob Stephen Kings Pennywise oder Mary Shelleys namenloses Monster aus Leichenteilen: Solche Geschichten haben eine lange Tradition, deren Erforschung ebenso interessant sein kann wie ihr Genuss. Ein Interview mit dem Theologen Marco Frenschkowski bietet Antworten auf einige Fragen.
Woher kommt die Faszination an unheimlichen, unerklärlichen Dingen? Wieso verbringen Menschen ihre Zeit mit Meistern des Schauerlichen, wie Edgar A. Poe, Bram Stoker, Gustav Meyrink, H. P. Lovecraft oder Stephen King? Wieso verbringen Autoren ihre Zeit damit, Geschichten von Monstern zu schreiben, die sie in ihrem Unterbewusstsein suchen und nicht mehr unter ihren Betten? Antworten auf solche Fragen gab ein Professor für evangelische Theologie in Leipzig. Dieser hatte bereits neben seiner Lehrtätigkeit an der Universität Leipzig seit vielen Jahren auch Forschungen im Bereich unheimlicher und fantastischer Literatur publiziert.
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Frenschkowski, woher, glauben Sie, kommt die menschliche Faszination für das Unheimliche, und welche gesellschaftlichen Gegebenheiten verleiten den Menschen zu seiner Lust am Gruseln?
Immer und zu allen Zeiten gab es in der Geschichte der Menschheit ein Interesse am Unheimlichen und Fantastischen. Man könnte sagen, dass jede Zeit die Monster erfindet, die ihr entsprechen. Monster verkörpern in der Literatur die Ängste der Gesellschaft in ihrer jeweiligen Epoche, ihrem jeweiligen kulturellen Profil. Im 18. Jahrhundert artikuliert zum Beispiel Friedrich Schiller mit seinem Roman »Der Geisterseher« die Angst der Menschen vor Geheimbünden und der Unüberschaubarkeit der realen Machtverhältnisse. Im späten 19. Jahrhundert steht die Erscheinung des Vampirs in der unheimlichen Literatur als Metapher für die Furcht vor einer verdrängten Sexualität. In der Novelle »Carmilla« verarbeitet der Autor Joseph Sheridan Le Fanu das Thema Homosexualität mit seiner Darstellung einer lesbischen Vampirin. Das späte 20. Jahrhundert erschuf die Angst vor den Konsequenzen der Naturausbeutung durch den Gedanken, dass der Mensch durch seine Ausbeute die Natur in ein Monster verwandeln könnte, zum Beispiel in den »Revenge of nature«-Filmen der 1970er und 1980er. Und in den 2000ern verarbeitet der Mensch mit dem Zombie als Monster die Angst, in der Gesellschaft sozusagen nur ein lebendiger Toter zu sein, eine dumpfe animalische Existenz unerfüllter Begierden zu führen.
Sie haben ein umfassendes, 13-bändiges Kommentarwerk zu den Erzählungen und Gedichten von H. P. Lovecraft verfasst. Welche Rolle sprechen Sie seinen Geschichten für die Entwicklung der unheimlichen und fantastischen Literatur zu?
Stephen King sagte einmal, dass es zwei Arten moderner Autoren im Bereich der fantastischen Literatur gibt: jene, die versuchen, wie Lovecraft zu schreiben, und jene, die versuchen, gerade nicht wie er zu schreiben. Das ist eine interessante Beobachtung: Lovecraft hat vor allem Autoren inspiriert. Edgar Allan Poe schrieb in seiner Zeit über die Abgründe der menschlichen Seele. H. P. Lovecrafts Geschichten setzen sich mit der Thematik der Unendlichkeit des Kosmos auseinander, mit der Konfrontation mit einem Universum, in dem der Mensch kaum Bedeutung hat. Das verbindet seine Prosa mit einer Einbindung in eine in hohem Maße realistische Schilderung seiner unmittelbaren amerikanischen Umwelt – ein bemerkenswerter Kontrast. Gerade als Atheist ist Lovecraft in paradoxer Weise ein religiöser Autor, wie schon Robert Bloch (der Autor von »Psycho«; Anm. d. Red.) gesagt hat, der ihn als junger Mann noch kennengelernt hatte. Die zentrale Thematik seiner Geschichten ist die Frage nach der Stellung des Menschen im Kosmos in einer Zeit, in der neue wissenschaftliche Erkenntnisse diesen Kosmos zunehmend fremd und unheimlich machten.
Welche Rolle spielt ihrer Meinung nach die Thematik der Geschlechterrollen in fantastischer Literatur?
In unheimlicher Literatur wird stets die Angst vor Unbekanntem verarbeitet. Zum Beispiel hat die Novelle »Carmilla« das Thema Homosexualität im 19. Jahrhundert
aufgenommen. Heute sind die komplizierten Verlagerungen und Verschiebungen der Geschlechtsrollen ein wichtiges Thema unheimlicher Literatur, wenn sie nicht nur klischeehaft Traditionelles wiederholt.
Welche Trends lassen sich in neuerer Zeit in der fantastischen Literatur erkennen?
Durch die Globalisierung fließen stärker Elemente anderer Kulturen in die unheimliche Literatur, zum Beispiel in die Literatur der deutschen und der englischen Sprache, ein. Neue Medien neben Buch und Film werden zu Trägern des Genres, Comics, Videospiele, interaktive Webseiten. Dennoch kommen auch da archaische, uralte Motive, Figuren und Handlungsmuster zum Tragen, zu deren Erforschung ich gelegentlich versuche, etwas beizutragen.
Gibt es somit eine Sehnsucht nach rational nicht erklärbaren Phänomenen, oder glauben Sie, dass das Bedürfnis nach gruseliger oder fantastischer Literatur zugunsten des naturwissenschaftlichen Fortschritts verschwinden wird?
Es gibt keinerlei Indizien, wonach das Fantastische weniger würde: ganz im Gegenteil. Gerade rationale Diskurse »verdrängen« Aspekte von Wirklichkeit und erzeugen Gegenbewegungen des Imaginativen, Monströsen, Unheimlichen. Ich wüsste nicht, warum sich das ändern sollte.