Weil es noch nicht genug unqualifizierte Meinungen da draußen gibt: hier der hastuzeit-exklusive Duo-Diskurs rund um Verteidigung, Abschreckung und Fragen aus der Debattenkultur, wie „Würdest du für Deutschland kämpfen?“
Julian: Aktuell wird ganz oft über die Wehrpflicht diskutiert. Da gibt es eine legalistische Perspektive, nämlich, was im Gesetz dazu steht und das, was reingeschrieben werden kann, was aber von den jeweiligen politischen Argumenten abhängt. Diese Debatte wird nun zunächst von der „Großen Koalition“ bestimmt. Die Umsetzung so einer Pflicht ist meiner Meinung nach totaler Humbug oder extrem schwierig, weil die Kapazitäten dafür nicht vorhanden sind. Es gibt zu wenige Kasernen. Die Ausrüstung müsste in Schuss gebracht werden. Aber zu der Wehrpflicht kann man ja trotzdem auch noch andere Sachen sagen.
Warum mich das beschäftigt, ist ja eigentlich, dass meine Perspektive sich auf das ganze Thema vor drei Jahren geändert hat, als der Ukraine-Krieg losging. Vorher war ich jetzt keiner, der sagte, dass man die Bundeswehr gleich abschaffen muss. Ich war dennoch eher auf der Linie, dass man sagt, es wäre doch schön, wenn man die nur noch für inländische Aufgaben einsetzt. Für so etwas wie Katastrophenschutz et cetera. Ich war vielleicht schon pazifistischer eingestellt. Und dann kam der Ukraine-Krieg. Irgendwas hat da Klick gemacht. Dazu kommt, dass ich eine Freundin aus meinem Abi-Jahrgang habe, die bei der Bundeswehr ist. Es macht schon einen Unterschied, wenn du mal Leute aus dem Fachgebiet kennst, mit denen du dich besser darüber unterhalten kannst. Boris Pistorius‘ Perspektive als Verteidigungsminister überzeugte mich plötzlich. Er hat da sehr meinen Nerv getroffen, muss ich sagen und auf der Linie bin ich auch in vielerlei Hinsicht geblieben. Da bin ich auf jeden Fall weggegangen von einem sehr linken Standpunkt.
Johannes: Das kann ich nachvollziehen. Meine Ausgangsposition ist, dass du als Pazifist in einer nicht-pazifistischen Welt nicht wirklich etwas bewegen kannst. Denn am Ende richten sich die Waffen auf dich. Ich sehe auch, dass der Ukraine-Krieg ein gewisses einschneidendes Ereignis war. Allerdings fasse ich das ein bisschen größer. Ich denke das Ganze auf einer europäischen Ebene und sage, dass Europa etwas tun muss. Eine eigene Armee aufstellen mit je nach Staat hochspezialisierten Einheiten, damit nicht jedes Land alles braucht. Damit ließe sich womöglich auch Geld sparen. Etwas, worin ich auch Bedarf sehe.

Julian: Für eine europäische Initiative wäre ich definitiv auch.
Johannes: Ich finde, wenn es um die Bundeswehr geht, werden immer gern Zahlen genannt, wie viel wir doch für Militär beziehungsweise für Verteidigung ausgeben und wie viel andere Staaten vergleichsweise ausgeben. Da sind wir schon weit vorne dabei. Natürlich wurde in den vergangenen Jahren viel kaputtgespart. Aber kommt das Geld, das Sondervermögen, dann auch wirklich dort an, wo es hingehen müsste? Oder ist das nicht einfach nur wieder ein Blankoscheck für irgendwelche teuren Anschaffungen, die dann als Presseschlagzeile enden, wie schlecht sie doch sind?
Julian: Ja, es darf jetzt nicht nur darum gehen, Ausrüstung zu kaufen, sondern es muss vor allem auch darum gehen, die aktuellen Bestände in Schuss zu bringen, Strukturen zu vereinfachen und zu verbessern. Ich kann mich noch sehr genau an eine „heuteShow“-Sendung von vor gar nicht so langer Zeit erinnern, in der es darum ging, dass es zu wenig Socken gibt. Solche Sachen müssen erst mal in großer Zahl vorhanden sein, damit wir über Gerät und Ähnliches reden können. Das geht bei den Kasernen los. Wir brauchen genug Kapazitäten, um die Soldat:innen überhaupt unterzubringen. Es muss erstmal einiges an Vorarbeit geleistet werden und dafür sollte das Geld auch da sein, bevor wir über neue Anschaffungen in großer Zahl reden.
Was mir gerade noch eingefallen ist: Wadephul [Deutscher Außenminister] hatte angekündigt, er stehe hinter dem 5 % Ziel von Trump [Anteil des BIP für Verteidigungsausgaben]. Finde ich auch Quatsch. Erstmal sollten wir versuchen, dass wir die 2 % regelmäßig schaffen, dann kann man weitersehen. Habeck hatte ja mal 3,5 % vorgeschlagen. Wenn wir mal ein paar Jahre hintereinander diese 2 % erreichen, dann können wir darüber reden, ob wir auch 3,5 % angehen sollten. Jetzt im aktuellen Zustand über 5 % zu reden, halte ich für völlig bescheuert.
Johannes: Da gehe ich mit. Allerdings muss ich dir auch widersprechen. Wir müssen die Einsparungen der letzten Jahre wieder aufholen. Das ist klar. Aber ich würde jetzt nicht in die Schiene abrutschen, von Jahr zu Jahr immer mehr in das Militär zu investieren. Irgendwo müssen die Mittel ja herkommen. Wir sehen: Aktuell war das Geld ja sehr locker, wenn es um die Verteidigung ging. Es wird durch Schulden herangeschafft – an anderen Stellen wird aber trotzdem gespart. Das sollte auch nicht so sein. Natürlich hat man dann immer noch das alte Wettrüsten vor Augen. Wenn jetzt jede:r immer mehr ins Militär steckt, zweifele ich daran, ob das wirklich zielführend ist.
Julian: Man muss dann noch ein bisschen die Außenpolitik im Blick haben. Wir wissen jetzt nicht, was in 5 bis 10 Jahren ist. Falls sich die Lage verschärft, dann müsste man vielleicht drüber nachdenken, ob man die Ausgaben erhöht. Ansonsten kann man auch erst mal bei dem 2%-Ziel bleiben. Wie gesagt, das einzuhalten ist schon schwer genug. Das haben die letzten Regierungen in Deutschland alle nicht geschafft. Ich glaube, wir hatten ein einziges Mal etwa 2,1%, aber ansonsten sind wir immer darunter geblieben und deswegen sollten wir uns da ein bisschen beruhigen.
Johannes: Diese Zahlen sagen zudem nicht wirklich aus, ob ein Militär etwas taugt. Man sollte sich vielleicht nicht zu sehr daran festklammern und dann eher auf Tatsachen schauen – was wurde in den letzten Jahren bewegt, was muss gemacht werden und wo ist man schon gut dabei? Wichtig ist der Überblick.

Häufig fällt auch das Stichwort „Abschreckung“, wenn es um derartige Investitionen geht. In den Medien kam unter anderem die Frage auf, was wäre, wenn die Ukraine noch die Atomwaffen gehabt hätte? Hätte Russland trotzdem angegriffen oder nicht? Es wird sogar über einen nuklearen Schirm für Europa diskutiert. Im Endeffekt muss irgendjemand auf den Knopf drücken – gleich mal so plakativ. Und diese Entscheidung ist ja dann immer gegenseitig: Wenn die eine Seite den Knopf drückt, drückt die andere auf den Knopf. Es kann natürlich immer noch kleine Ausnahmen geben, das hat die Geschichte gezeigt, dass auch bei Fehlalarm doch manche Menschen nicht gleich diese Befehle von oben befolgen. Aber was, wenn das alles irgendwann vollständig automatisiert ist?
Einmal sehr negativ in die Zukunft gedacht: Angenommen, Russland würde das Baltikum übernehmen. Setzt man da dann Atomwaffen ein? Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, inwiefern andere Waffen großartig abschrecken. Wir sehen ja wie eben Putin vor keinen Menschenverlusten zurückschreckt. Das ist denen einfach egal. Er will sein Land vergrößern und nimmt dafür eigentlich alles in Kauf, solange er es sich nicht mit seinen internationalen Partnern, die noch auf seiner Seite stehen, verscherzt. So lange funktioniert das. Da bleibt die Frage: Inwiefern hilft Abschreckung?
Julian: Also was die Atomwaffen angeht, so glaube ich, dass ich einem Wladimir Putin – so irrsinnig der auch sein mag – immer noch zutraue, dass er weiß: wenn eine:r den Knopf drückt, drücken ihn alle. Und bei Putin wird ja oft auch gesagt, der will sein sowjetisches Reich wieder aufbauen und da wäre ihm natürlich nicht geholfen, wenn alle auf besagten Knopf drücken, denn dann ist ohnehin alles vorbei. Das kann man empirisch nicht nachweisen. Das ist dann einfach meine Überzeugung, dass keiner so schnell einen unruhigen Finger kriegt.
Das hält nun nicht davon ab, dass konventionelle Kriege geführt werden. Das ist ein Problem. Ich habe aber immer noch die Hoffnung, dass eine NATO als Verbund eine dermaßen große Präsenz hat, dass das auch reicht. Du kennst sicher den hypothetischen Präzedenzfall in Estland, dass dort ein kleines Dorf ist oder eine kleine Stadt – direkt an der russischen Grenze. Würde Putin dort angreifen, wäre es theoretisch der Verteidigungsfall und man stellt in Frage, wie weit die NATO gehen würde, für „nur“ 60.000 Leute. Daher ist auch fraglich, ob der Bündnisfall funktioniert. Trotzdem glaube ich, dass es zum Beispiel hilft, Staaten in die NATO oder die EU zu holen. Wenn die Staaten das von sich aus wollen, dann sollen sie das tun dürfen und dann sollten wir auch bereit sein, diese Staaten aufzunehmen. Weil das dann hoffentlich auch einen besseren Schutz darstellt. Das Prinzip funktioniert so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Ich hoffe einfach, dass diese Wirkung einer NATO und auch die dieses roten Knopfes noch groß genug ist, um alles nicht so schnell hochkochen zu lassen.
Johannes: Ja, ich finde aber, man muss, wenn man die NATO anspricht, auch sagen, dass ihr Konzept nicht wirklich so ausgereift ist, dass es wirklich perfekt wäre. Nichts ist perfekt, aber dieses Bündnis hat definitiv viele Probleme. Ein Paradebeispiel ist die Türkei – ein Mitglied, welches durchaus kritikwürdig ist. Sei es die sehr nahe Zusammenarbeit mit Russland oder die Kriege, die Erdogan führt beziehungsweise unterstützt. Natürlich ist die Türkei auch keine lupenreine Demokratie mehr. Und was ist, wenn zwischen zwei NATO-Mitgliedern ein Krieg ausbricht?
Zudem hat sich die NATO in der Vergangenheit auch nicht immer mit Ruhm bekleckert. Ich sage aber trotzdem, dass sich meine Sicht auf sie durch den Ukraine-Krieg stark verändert hat. Davor war ich noch extrem kritisch. Jetzt mit dem Krieg hat man doch auch gemerkt, dass vielleicht die Ausrufung des Bündnisfalls eine gewisse abschreckende Wirkung haben kann. Wir sehen: Schweden und Finnland sind ja beigetreten aus genau diesem Grund – weil sie eben fürchten, dass Putins Blick gen Skandinavien schweifen könnte. Hinzu kommt ein unberechenbarer Trump. Wobei es auch jemanden nach Trump geben wird, oder?
Julian: Hoffentlich ja.
Johannes: Sollte man sich vielleicht dann nicht zu sehr auf die NATO verlassen?
Julian: Nee, das nicht. Die NATO ist mehrheitlich durch US-Politik geprägt. Es muss jetzt gelten: Europa muss für sich selbst handlungsfähig sein und auch Verantwortungen übernehmen. Es ist immer noch ein bisschen dieser alte Ruf der NATO, der da abschreckend wirken kann. Aber der Ausnahmefall mit dem Krieg zwischen zwei Bündnis-Staaten – also Gott bewahre, dass das jemals passieren möge – das ist natürlich auch eine interessante Fragestellung, wie das dann aussähe.

Wir hatten vorhin bereits über das „Verschleppen“ von Bundeswehrgeldern und das Kaputtsparen gesprochen. Das fing ja vielleicht nicht erst da an, aber ganz akut wurde es 2011 mit der Aussetzung der Wehrpflicht. Beziehungsweise begann damals das gesellschaftliche „Mindset“ beim Thema Armee auszusetzen. Eine Wehrpflicht, in der alten Form wieder einzuführen ist nicht zielführend. Trotzdem bin ich der Ansicht, dass eben diese Aussetzung der Wehrpflicht 2011 zu einem falschen Sicherheitsgefühl führte und die Armee damit auf lange Sicht unbrauchbar gemacht worden ist. Zum einen, weil die Leute fehlten und zum anderen Mal eben die Ausrüstung ignoriert worden ist. Die Kehrseite dessen ist heute, dass man zum Beispiel Bundeswehrwerbung in Schulen hat oder beim ÖPNV. Das Tor hat man sich einfach selbst geschossen mit dem Aussetzen der Wehrpflicht oder besser gesagt: dass man damit die gänzliche Beschäftigung mit dem Thema Bundeswehr auch innerhalb der Zivilgesellschaft für beendet erklärt hatte, das war ein kapitaler Fehler.
Johannes: Die Aussetzung der Wehrpflicht finde ich richtig. Es gibt natürlich auch andere Staaten, wo eine Armee ohne Wehrpflicht funktioniert. Natürlich sind das andere Systeme. Da wird immer gerne auch die USA genannt.
Julian: Ja, völlig andere Kultur.
Johannes: Genau. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass es unbedingt eine Wehrpflicht braucht, damit Verteidigung funktioniert. Zum anderen Punkt, den du angesprochen hast, dass das alles ein bisschen aus der Gesellschaft verschwunden ist. Wie sieht denn die Wahrnehmung der Leute aus? In den Nachrichten oder auch in der „heuteShow“ hört man meistens nur Sachen, wenn etwas schief läuft. Dann wird sich darüber lustig gemacht und jede:r weiß, wie schlecht doch unsere Bundeswehr ist.
In den USA ist das ja natürlich anders. Besonders wie die Soldat:innen geschätzt werden. Da kann man sicherlich auch drüber diskutieren, inwiefern das positiv ist. Ich denke aber, man sollte durchaus ein bisschen Respekt dafür haben, dass Menschen sich entscheiden – nicht nur alleine des Geldes wegen – zum Bund zu gehen.
Natürlich gibt es auch andere Vorzüge und die meisten Menschen sind beim Bund, weil der eben relativ gut bezahlt. Die gesellschaftliche Schätzung ist hier in Deutschland aber etwas anders und nicht so extrem – wahrscheinlich auch historisch bedingt.
Julian: Ja, wir sollten natürlich nicht gleich wieder ins komplette Gegenteil abkippen, dass wir sagen, wir fangen jetzt an, die Gesellschaft zu militarisieren und ein „Hurra“ auf Waffen zu singen, wie in den USA. Das ist das, was du meinst – die USA sind eine völlig andere Welt. Die haben vor allem mit ihrem Second Amendment eine ganz andere Waffenkultur. Auch die Wertschätzung von Soldat:innen ist eine andere geworden und man schaut nicht mehr so abschätzig auf sie. Man muss kein Fan der Bundeswehr sein, aber dass man wenigstens den Anstand hat zu sagen: „Okay, dieser Mensch – aus welchen Gründen auch immer – ist bereit sein Leben für mich zu geben, obwohl er mich nicht kennt.“ Diesen Grundrespekt zu haben, finde ich jetzt nicht völlig verkehrt.
Diese Abwehrhaltung gegenüber der Bundeswehr und dem Dienst an der Waffe stammt nach meiner Wahrnehmung ausschließlich aus der ganz linken Ecke. Da ist mir dann aufgefallen, dass das Argument immer wieder war, dass die linke Politik sich dadurch auszeichnen will, dass man solidarisch miteinander ist. Ich erinnere mich an ein schönes Gespräch zwischen einem Soldaten und einem jungen Menschen von der Links-Jugend. Der Soldat meinte dann: „Naja, aber was ist solidarischer? Dass du sagst: ‚Nee, ich will nur, dass meine Familie in Sicherheit ist und deswegen würde ich fliehen und würde nicht zum Bund gehen.‘ oder dass ich sage: ‚Ich kenne dich zwar nicht, aber weil wir eine Gemeinschaft sind, würde ich auch für dich kämpfen.‘“ Den Vergleich fand ich interessant. Da wird die Solidarität auf die Probe gestellt.
Johannes: Ja, ich finde diese Solidaritätsfrage kann man stellen. Allerdings tue ich mich auch so ein bisschen schwer damit, jetzt zu sagen, dass die ganzen Soldat:innen für mich kämpfen, sollte irgendetwas sein – denn für mich kämpfen die ja nicht direkt. Es ist eine Frage des eigenen Standpunktes, wofür man denn wirklich kämpft. Ich weiß nicht, ob man sich es damit nicht zu leicht macht, wenn man immer sagt: „Ja, ich kämpfe doch auch für dich.“ Und diese Contrahaltung gibt es nicht nur von links, sondern man hört auch von rechts: „Ja nee, für Deutschland würde ich nicht kämpfen“ – das hat natürlich dann andere Gründe.
Julian: Genau, für DIESES Deutschland (lacht).
Johannes: Es ist immer eine Frage der Perspektive. Ich würde dann gleich einmal einfach so das Fass aufmachen: Wofür kämpft man denn? Wofür will man kämpfen? Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Jetzt sind wir schon fast beim Schlager angekommen.
Ich persönlich beispielsweise sehe mich jetzt nicht Deutschland verpflichtet. Ich sehe mich natürlich jetzt auch nicht als Deutscher – als Hauptbestandteil meiner Identität – sondern sehe viel eher noch den Bezug zu meiner Heimat. Also da, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin – meine Kleinstadt, maximal mein Landkreis. Aber darüber hinaus wird es dann halt schon schwierig, wenn man da wenig Berührungspunkte hatte. Wie oft war man denn schon überall in Deutschland?
Der Ausdruck „für Deutschland kämpfen“ ist auch irgendwie ein bisschen seltsam. Natürlich kann man sagen: „für die Gemeinschaft“, aber diese findet im Endeffekt nicht auf der großen Ebene statt – eher auf einer kleineren in den Städten, in den Gemeinden. Das geht allerdings zum Teil verloren.
Ein anderer Punkt. Zu dem Thema habe ich etliche Politiker:innen reden hören, die auf die Frage: „Würden sie für Deutschland kämpfen?“ ohne mit der Wimper zu zucken mit „Ja!“ geantwortet haben – wo ich mir so gedacht habe, dass gerade im Kriegsfall diese Personen eben nicht für das Land kämpfen werden. Es sind immer andere. Wir sehen das zum Beispiel in Russland. Politiker:innen-Kindern geht es gut – die sind nicht an der Front, sondern irgendwo im Ausland untergekommen oder wurden irgendwie anders in Sicherheit gebracht.
Viel wichtiger ist, dass man anerkennt, dass diese sehr hypothetische Frage nicht so einfach zu beantworten ist. Und dass man auf Menschen, die bei dieser Frage zögern oder mit „Nein“ antworten, nicht von oben herabschaut, wie manche überzeugte Ja-Sager:innen das tun.
Julian: Ich halte es für vermessen, wenn sich Leute hinstellen, vor allem die es nicht betrifft, und sagen: „Ja natürlich würde ich das machen.“. Da fand ich die Antwort von Philipp Türmer, dem Juso-Vorsitzenden, ganz gut. Der meinte: „Ich würde mir wünschen, dass ich – wenn es so weit ist – dann tatsächlich den Mut hätte, das zu machen.“ Das ist auch meine Position. Ich würde mir schon wünschen, dass ich im Fall der Fälle die Kraft hätte, zu sagen: „Ich gehe hin und kämpfe mit!“
Den Satz „für Deutschland kämpfen“ finde ich auch falsch und das haben die Soldat:innen, mit denen ich gesprochen habe anders formuliert. Die haben treffend gesagt: „Ich kämpfe dafür, dass meine Freunde oder Familie es nicht machen müssen.“ Das finde ich schon eine gute Motivation, aber noch viel geiler fand ich den Satz: „Ich kämpfe für die fdGO, die freiheitlich demokratische Grundordnung.“ Für den unveränderbaren Teil des Grundgesetzes. Und das muss ich sagen, da stehe ich sehr deutlich dahinter. Denn diese fdGO zu verteidigen, bedeutet am Ende den liberalen, demokratischen Staat zu verteidigen.
Und wenn man politisch gegen Teile oder auch vielleicht gegen das ganze Konzept, das politische System dahinter ist, dann kann man das trotzdem nur ausleben, wenn man innerhalb dieses Staates erstmal lebt.

Wenn ich unterdrückt werde und wenn wir jetzt mal das sehr plakative Szenario nehmen, Russland überfiele Deutschland. Wir sagen jetzt mal, wir wollen alle nicht kämpfen. Wir ergeben uns jetzt einfach so. Dann brauche ich mir natürlich über Systemopposition keine Gedanken mehr zu machen, denn dann sind wir Opfer im eigenen Land. Und deswegen finde ich das Argument zur fdGO richtig. Es ist der rechtliche Rahmen dafür, sagen zu können: „Ich verteidige die Freiheit dafür, dass auch die, die mich nicht mögen und auch nicht mögen müssen trotzdem genau das ausleben dürfen.“ Das war für mich einer der stärksten Pro-Punkte an der Stelle.
Johannes:Ich kann mir vorstellen, dass gerade hier im Osten, die Erfahrungen mit den misslungenen Wendejahren und allen negativen Folgen, die das bis heute nach sich zieht, nicht gerade dazu beigetragen haben, dass mehr Menschen „für dieses Deutschland kämpfen“ würden.
Auf der anderen Seite hast du es ja so übertrieben: Russland greift Deutschland an und dann ist alles weg. Das ist natürlich ein extrem unwahrscheinlicher Fall. Ich finde, man muss sich auch von der Vorstellung verabschieden, dass die Kriege der Zukunft noch mit Fußsoldat:innen ausgefochten werden. Wir sehen gerade, wie es in der Ukraine läuft. Die Zukunftskriege – das sind Drohnenkriege und das wird nicht viele Menschen brauchen, was eine Wehrpflicht obsolet macht. Vielleicht wird auch eine dystopische Zukunftsvorstellung wahr, in der irgendwann nur noch Roboterarmeen gegeneinander kämpfen. Krieg an sich ist natürlich vieles: krank, verschwenderisch und nicht klimaneutral.
Zur Personalfrage: Man muss halt wirklich nur die wichtigen Posten besetzen und sicherlich auch die Bundeswehr spezialisieren. Da brauchen wir keine Wehrpflicht. Und dahingehend denke ich, dass diese Debatte um eine Wehrpflicht komplett falsch gedacht ist.
Viel wichtiger sehe ich da Folgendes: Es muss ja nicht so sein, dass russische Soldaten in Estland die Grenze überschreiten und dann der Bündnisfall folgt. Nein – wir erleben ja jetzt schon, wie Russland sich hier in Deutschland in die Politik einmischt – auch aktiv im letzten Wahlkampf. Beispielsweise mit der Aktion gegen die Grünen und auch mit russischen Bots auf Social Media. Hybride Kriegsführung in Form von Cyberangriffen spielt da auch eine entscheidende Rolle.
Julian: Ja absolut, die haben auch massiv zugenommen.
Johannes: Für meine Sicherheit ist es doch ein viel größeres Risiko, wenn das nahegelegenste Atomkraftwerk in Frankreich oder Belgien attackiert wird, als dass ich jetzt damit rechnen müsste, dass irgendwann der Russe vor meiner Haustür steht. Cybersicherheit ist enorm wichtig geworden.
Julian: Da braucht es mit Sicherheit auch große Veränderungen. Der Krieg von heute und von morgen ist sowieso ein asymmetrischer Krieg, der viel im Cyberraum stattfindet. Das ist mittlerweile auch bei den Oberstrateg:innen und bei den Expert:innen angekommen. Das löst man nicht mit Personal im Landgefecht, das ist klar. Das ist auch ein eigener Komplex, der vielleicht nochmal eine eigenständige Betrachtung verdient, weil es sehr komplex ist. Jedenfalls sollte Krieg immer die Ultima Ratio bleiben. Wir dürfen Krieg nicht normalisieren und weil du es kurz angesprochen hast: Krieg ist nicht klimaneutral, Krieg hat katastrophale Folgen – Moral wird über den Haufen geworfen. Man darf es nicht zu sehr „hochhypen“.
Johannes: Ich will dann vielleicht noch ergänzen: wenn jetzt Putin das Baltikum angreift, dann würden ja auch nicht die, die eingezogen werden, dorthin geschickt – sondern ausgebildete Soldat:innen.
Julian: Richtig.
Johannes: Was ja auch grundsätzlich erst einmal nicht falsch ist. Aber worüber diskutieren wir? „Würden wir für Deutschland kämpfen?“ Soweit ist es doch ewig nicht! Der Diskurs ist irgendwie ganz verschoben.
Lohnt sich das ganze Geld überhaupt? Wir sprechen von enormen Summen. Aber dann muss man halt auch fragen: Kommen die finanziellen Mittel da an, wo sie dringend gebraucht werden? Die Soldat:innen müssen im Endeffekt mehr einbezogen werden, denn die wissen am besten, was angeschafft werden muss.
Julian: Absolut! Und du hast recht, die Debatten drehen sich teilweise um die falschen Fragen.
Johannes: Definitiv! Es wird ja jetzt in Europa schon ganz viel für mehr Verteidigung investiert. Natürlich kann man argumentieren, dass das richtig sei im Angesicht des Ukraine-Krieges. Man darf aber nicht vergessen, dass es im Endeffekt Unternehmen sind, die davon profitieren und die dann auch Einfluss auf die Politik nehmen. Da muss man doch fragen: „Wie viel Aufrüstung ist wirklich gut?“ Auf der anderen Seite muss die Bundeswehr irgendwie modernisiert werden, weil wir ja leider in einer Welt leben, in der wir eben so etwas noch brauchen.
Julian: Ja, richtig. Das mit den Firmen sehe ich genauso. Also ich bin dafür, dass man solche „kritische Infrastruktur“, die zur Bundeswehr gehört, verstaatlicht. Ich habe kein Konzept, wie das konkret aussehen könnte, aber meiner Meinung nach müsste Waffenproduktion und ‑vertrieb alles staatlich geregelt sein. Niemand sollte private Gewinne aus so etwas heraus erzielen können.
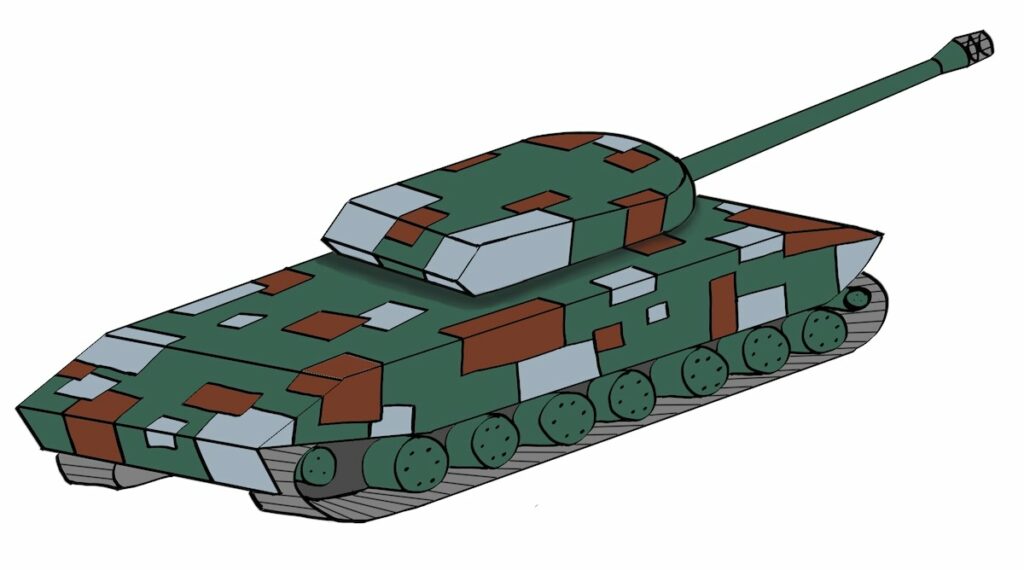
Johannes: Da schließt sich auch ein wenig wieder der Kreis. Die ganzen Waffenfirmen in Europa, die sind zum Teil ja auch schon spezialisiert. Das geht dann Hand in Hand, wenn man die europäischen Armeen alle zusammenlegen würde – mit den jeweiligen Spezialisierungen.
Julian: Es gibt ja im Endeffekt nur diese zwei Optionen. Entweder hast du es privatisiert, so wie jetzt. Aber aus diesem Extremfall „Krieg“ mit all seinen Konsequenzen sollte nun nicht noch extra jemand Kapital schlagen, daher ist eine Verstaatlichung am Ende die einzige andere Option. Wie das dann konkret aussehen kann, da können sich Leute mit beschäftigen, die mehr Ahnung davon haben als wir.
Was mir bei dieser ganzen Pflichtdienst-Diskussion noch wichtig war: Ich kann verstehen, wenn junge Leute sagen „Warum soll ich jetzt mich irgendwie verpflichten? Uns wird immer nur abverlangt, aber uns wird nichts entgegengebracht.“ Allein auf die jungen Leute bezogen finde ich das einen guten Punkt. Es wird immer noch faktisch zu wenig für den Klimaschutz getan, die Rente wird nicht entsprechend angegangen. Arbeitsmarkt, Migration sind alles weitere Themen, die junge Erwachsene auch beschäftigen und da sollte man den jungen Menschen ein bisschen entgegenkommen, wenn man etwas von ihnen fordert.
Auf der anderen Seite glaube ich trotzdem, dass man den Menschen auch wieder etwas abverlangen darf. Der von mir mittlerweile wenig geschätzte Richard David Precht hat vor fünf Jahren mal noch was sehr intelligentes gesagt: „Die Leute benehmen sich im Staat mittlerweile wie in einem Supermarkt.“ Wir haben gelernt, dass da so ein negatives Freiheitsbild eine große Rolle spielt. Wir werden davor geschützt, dass wir irgendwas machen müssen. Über Pflichten wird selten geredet, weil wir eben einfach sehr „freiheitsbesoffen“ geworden sind. Wir mögen es nicht, wenn uns irgendwelche Sachen an den kleinsten Stellen einschränken, aber Bürger:innen eines Staates, einer liberalen Demokratie zu sein, bedeutet nicht, dass ich mich nur zurücklehnen darf und immer kriege, kriege, kriege – sondern dass ich dafür eben auch irgendwas tun muss.
Johannes: Zu diesem, dass man den jungen Menschen wieder was abverlangen muss: Ich finde das richtig schrecklich, wenn irgendwelche Boomer anfangen das zu sagen. Gerade im Hinblick auf die Wehrpflicht oder das soziale Pflichtjahr. Das ist ja das andere Konzept, womit man dann versuchen will, ein paar Lücken zu schließen – mehr oder weniger.
Und was macht man mit denen, die sich dagegen verweigern? Werden die dann eingesperrt oder bekommen die „nur“ eine Geldstrafe? Das schreit ja wieder nach Klassenkampf, denn nicht jede:r kann sich das leisten. Solidarität kann man nicht erzwingen.
Julian: Das ist ein schönes Stichwort! Ich weiß nicht, ob du das Böckenförde-Diktum kennst, aber das besagt, dass der freiheitlich säkulare Staat von Bedingungen lebt, die er nicht selber schaffen kann. Das stimmt natürlich. Solidarität muss eben auch von den Leuten selbst kommen. Wir müssen auch einsehen, dass du einen Staat oder ein politisches System nur kritisieren und verändern kannst, wenn du die Chance hast, darin zu leben. Und das geht eben nur, wenn alle sich bewusst sind, dass dieser Staat eben nicht von sich selbst lebt, sondern dass wir alle daran Anteil haben.
Johannes: Ich will vielleicht noch ganz kurz eine Sache ansprechen, die ich auf deinem Zettelchen gesehen habe bei den Contra-Argumenten. Da ging es irgendwie um Anarchisten und wie die zum Staat stehen.
Julian: Genau.
Johannes: Also ich bin kein Anarchist. Allerdings glaub ich, das schlägt in diese Kerbe. Dieses Argument, was sicherlich viele irgendwie einfach nur so denken, salopp auch sagen würden: „Was hat der Staat für mich getan?“ Oder auch: „Warum verlangt der Staat etwas von mir? Warum will der Staat, dass ich für ihn in den Krieg ziehe oder dieses Pflichtjahr mache?“
Auf kleiner Ebene kann ich fragen: „Was hat die Gemeinde für mich gemacht?“ Ja gut, die Schule ist da, dort ist ein Spielplatz, der Radweg ist neu und so weiter. Das alles ist ein bisschen greifbarer als das, was jetzt das gesamte Staatskonstrukt für mich getan hat.
Julian: Ja, das ist richtig. Was man aber nicht so wirklich wegdiskutieren kann ist, es geht uns trotzdem im Durchschnitt verhältnismäßig gut. Und dass wir überhaupt in der Lage sind, diese Kritik üben zu können, dass wir auch diese Freiheit haben und dass wir nicht in den Knast gesteckt werden, nur weil wir mal eine andere Meinung zur herrschenden Politik haben, das ist doch etwas, für das es sich meiner Meinung nach lohnt, auch zu kämpfen – zunächst ganz politisch.
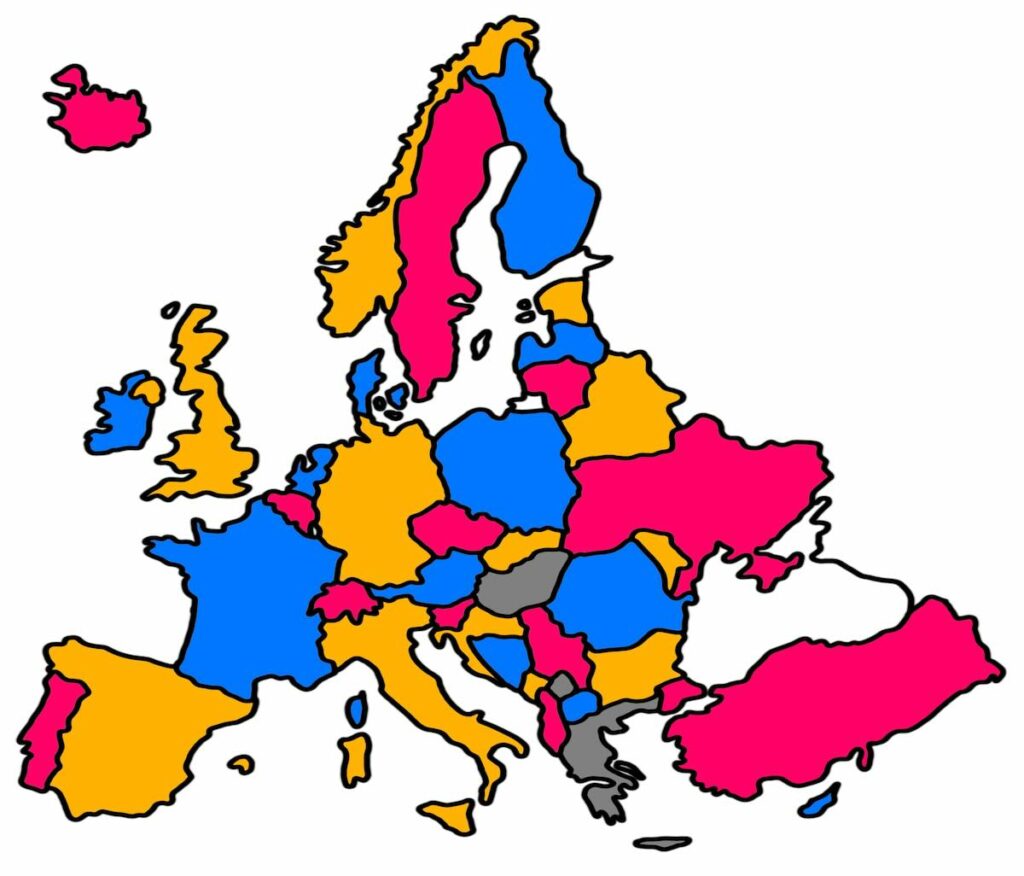
Natürlich kann ich fragen: „Was hat der Staat je für mich getan?“ Na ja, er sorgt an vielerlei Stelle erstmal dafür, dass man überhaupt das Leben so führen kann, wie man es führen kann. Und ohne, dass es ihn überhaupt gäbe, wäre das Leben so, wie es ist, eben auch nicht möglich. Viele, auch die, die total kritisch sind gegenüber dem System, profitieren an vielen Stellen davon – sind vielleicht sogar selbst privilegiert geboren. Dadurch können sie überhaupt erst dazu kommen, diese Kritik zu üben. Das hängt alles am Ende miteinander zusammen und dann einfach so drüber zu wischen und zu sagen: „Der Staat hat ja nie irgendwie was für mich getan. Er hat gar keine Bedeutung für mich. Warum soll ich mich dafür einsetzen?“ Das finde ich dann auch ein bisschen zu kurz und zu einfach gedacht.
Johannes: Ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, dass es uns nicht so schlecht ginge, denn man sollte sich auf dieser Aussage nicht ausruhen. Trotzdem würde ich sagen, dass man wegen der ganzen Mängel, die dieses Land hat, die unsere Demokratie hat, die unser System hat, das Land Deutschland nicht aufgeben sollte.
Julian: Genau, nur so kann man Veränderungen erzielen. Wenn man erstmal anerkennt, dass es gewisse Strukturen vielleicht braucht, um auch Sachen besser werden zu lassen.
Autoren: Johannes Wingert und Julian Herold
