Zugfahrten könnten so angenehm sein, wäre mir kein Fluch auferlegt worden. Es sollte mir nie gestattet sein, ohne eine zumindest mittelmäßig traumatische Erfahrung auszusteigen. Ich muss eines der Vorstandsmitglieder der DB AG mit Hang zur Hexerei verärgert haben.
Es ist endlich so weit!
Ich habe neben einer Menge Traumata auch noch genug Bahn-Bonus-Punkte gesammelt, um mir ein luxuriöses Upgrade in die erste Klasse zu gönnen. Die 500 Bonuspunkte sind mir die Hoffnung auf eine endlich angenehme Fahrt wert. Hätte ich noch 250 mehr gesammelt, hätte ich mir den großen Traum eines eigenen Unkrautstechers erfüllen können. Aber man kann nicht alles haben.

Meiner entspannten Fahrt mit der Bahn sollte also nichts im Weg stehen. Die ersten 60 Kilometer verlaufen ohne nennenswerte Zwischenfälle. Mein reservierter Sitzplatz (man gönnt sich ja sonst nichts) ist frei, das Abteil ruhig und meine Laune gut, auch wenn mir entgegen meiner Erwartungen niemand beim Betreten der ersten Klasse ein Glas Champagner angeboten hat. So gut, dass ich gar nicht an mögliche Zwischenfälle denke. Doch dann wird aus dem leisen Rattern der Räder Stille. Das kann kein gutes Zeichen sein. Wir haben gehalten. Außerplanmäßig!!!
Da ertönt sie schon, die kaum verständliche, blecherne Stimme des Schaffners. Zwischen vielen „Ähs“ und „Ems“ geht hervor, dass er glaubt, gleich weiterfahren zu können. „Glauben ist nicht wissen“, murmle ich. Sofort läuft es mir kalt den Rücken herunter und ich muss mich schütteln. Diesen Satz kenne ich nur von Lehrer:innen, die einem zeigen, dass sie nach ihrem Abi noch ein bisschen weiter nach einem anderen Beruf hätten Ausschau halten sollen. Am liebsten hätte ich mir den Mund mit Seife ausgewaschen, auf der Stelle gekotzt oder irgendwas dazwischen.
Stadt, Land, Stillstand
Lange passiert gar nichts. Ich versuche, positiv zu denken. Immerhin bin ich Teil der Oberschicht des Zuges. Mir kann niemand was. Auch die traurigen Blicke nicht, die der niedere Pöbel der Reisenden der Holzklasse ohne Sitzplatzreservierung durch die Glastür wirft. Während ich langsam immer nervöser in meinem komfortablen Sitz hin und her rutsche, meldet sich unser Schaffner wieder zu Wort: Meine schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten sich. Das wird hier länger dauern. Durch das Knacken und Knistern der Lautsprecher hört es sich so an, als erzähle er irgendetwas über Probleme mit der Weiche oder Leiche. Jedenfalls gehe erstmal nichts vorwärts, und da einige Passagier:innen stehen müssen, sei nun auch meine geschätzte erste Klasse für alle freigegeben. Das Einzige, was je von Wert für mich war, meine einzige Freude! Ich muss Stagnatos, den Gott der Bahnen, wirklich verärgert haben.
Die Glastüren, die zuvor die obere von der unteren Schicht trennten, öffnen sich und die einst so scharfen Grenzen zwischen den Klassen sind aufgehoben. Als Erstes wagt eine wilde Horde Achtklässler:innen auf Schulausflug den Vorstoß in das Reich der besseren Polster und des größeren Komforts. Sofort steigt mir der typische Teenagerduft von Energydrinks, dem kläglichen Versuch, den pubertären Schweiß mit Axe-Deo zu übertünchen, und Erdnussflips mit einer Herznote BiFi in die Nase. Aber solange sie mit ihren Handys beschäftigt sind, verhalten sie sich angemessen. Doch schon bald kommt es, wie es kommen muss: TikTok und Instagram sind bis zum Ende durchgescrollt.

Was bleibt da noch? Die Gruppe entscheidet sich für ein uraltes Spiel. Den meisten nur noch aus Überlieferungen bekannt: Es wird Stadt-Land-Fluss gespielt. Die 20 Kids werden ruhig. Es ertönt das obligatorische „A“ und kurz darauf auch schon „Stopp“. Der Buchstabe ist „K“. Das sorgt in der Kategorie „Promi“ für Diskussionen. Wie werden die Punkte bei den Kardashians vergeben? Wird zwischen Kim, Kourtney und Khloé unterschieden? Zählt „Kardashians“ als Überbegriff überhaupt? Und wie fallen die Jenners Kris, Kendall und Kylie ins Gewicht?
Keine Rücksicht auf Sitzplatzverluste
Ich belausche mit einem Ohr aufmerksam den Streit eines Cosplay-Pärchens, das wegen der Verspätung nicht mehr rechtzeitig zur Comic-Con kommen würde. Ihre Gemüter sind erhitzt, das Gespräch wird immer lauter und der letzte geschriene Satz: „Nein, Lionel! Ich habe acht Stunden an deiner Weste gearbeitet, wir gehen da noch hin!“ wird von einer neuen Durchsage zum Punkt gebracht.
„Es geht nichts mehr auf unserer Strecke“, heißt es. Es komme ein Evakuierungszug, in den wir über kleine Leitern klettern sollen. Um Panik zu vermeiden, werde dabei wagenweise vorgegangen. Als wir an der Reihe sind, stehe ich inmitten der mittlerweile sehr lauten Achtklässler:innen. Vor mir bekniet ein Junge seinen Kumpel, ihm noch einmal Fotos seiner ältesten Schwester zu zeigen, die er „so mega hot“ findet. Hinter mir wird neuer Lipgloss Geschmacksrichtung Zuckerwatte aufgelegt, während die Lehrerin die Vollständigkeit ihrer Klasse überprüft. Ich sehe, wie sie immer wieder von Neuem zu zählen beginnt, während ihr Gesichtsausdruck immer verzweifelter wird. Sie zählt ein Kind zu viel. Mich! Ich schaue sie lange und eindringlich an. Wir halten Blickkontakt; ich schüttle dabei langsam den Kopf. Dann fällt auch ihr der Fehler auf. Das kann bei meiner Größe und in der Hektik schon einmal passieren.
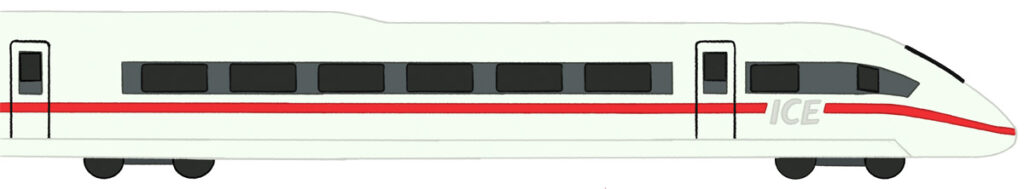
Als ich schließlich über die kleine Leiter kraxle, gilt mein einziger Gedanke ausschließlich der neuen Sitzverteilung, bei der weder meine Reservierung noch meine Klasse berücksichtigt wird. Diesen Verlust möchte ich nicht wahrhaben und befinde mich damit in Trauerphase eins: Leugnen. Aber im Zuge (im Zuge … ich hasse mich!) des Umstiegs konnte ich vom Großraum- in ein Sechserabteil umsteigen. Im Großraum ist die Idiotendichte einfach höher. Es gibt immer jemanden, der gerade zu laut privat oder geschäftlich telefoniert, und irgendein Kind hat immer ausgerechnet jetzt Lust auf ein Mettbrötchen mit extra Zwiebeln oder einen Döner mit allem und viel Knoblauch.
Kurze Zeit später werde ich gefragt, ob bei mir noch frei sei. Ohne weiter aufzusehen, bejahe ich die Frage. Es setzt sich ein Typ zu mir; das Aftershave treibt mir die Tränen in die Augen und ich bin mir sicher, es auch schmecken zu können. Ich wünsche mir den Pubertätsschweiß sehnlichst zurück. Jetzt schaue ich doch den Ursprung dieser Wolke einmal richtig an: Glatze, gerade noch nicht verfassungsfeindliche Tattoos und keine Kopfhörer oder Ähnliches; nur ein starrer Blick geradeaus. Zu meiner Erleichterung steigt er gleich am nächsten Halt aus und ich kann auf- und durchatmen.
Diese Ruhe wird mir nicht lange gegönnt. Ein Mann vom Typ Barfußschuh und Bouldern steigt zu und nimmt bei mir Platz. Schon wenige Minuten später hat der die Tupperbox gezückt und öffnet sie. Daraus steigt ein Duft auf, der nur aus der olfaktorischen Abteilung der Hölle stammen kann: Harzer Käse, Kohlrabi und Radieschen. Sein Kiefer arbeitet weniger hart an der Rohkost als ich daran, meinen Würgereiz zu unterdrücken. Als er seine Büchse der Pandora wieder schließt, ist mir schon schwindelig vom ganzen Luftanhalten. Aber was ist das? In jedem von uns steckt ein Arschloch! Ich muss wieder feststellen, dass der Zug der Ort ist, an dem man Menschen am besten hassen kann. Er beginnt auf dem Sitz neben sich einen ganzen Turm aus kleinen Döschen, Gläsern und Boxen mit undefinierbarem, aber sicher fermentiertem Inhalt zu stapeln.
Der schiefe Turm von Fermentisa konnte einen weiteren Reisenden nicht davon abhalten, zu uns ins Abteil zu steigen. Der ältere Herr im braunen Tweed-Anzug setzt sich mir gegenüber ans Fenster. Er sieht sich um, als wollte er sich vor etwas vergewissern, und greift in seine lederne Laptoptasche.

Heraus zaubert er einen Pappbecher und einen Piccolo-Rotwein im edelsten Fläschchen, das ich jemals gesehen habe. Sowohl die Flaschenform als auch das Etikett mit Goldverzierung schreien förmlich: „Selbst die erste Klasse ist nicht gut genug für mich!“ Er gießt sich liebevoll einen kleinen Schluck in den Papierbecher und schwenkt ihn inbrünstig. Der jüngere Rohkostfanatiker mit Holzschmuck zu seiner Rechten fühlt sich animiert und öffnet ein Jever. Zwei Parallelwelten, nur getrennt von einem wild gemusterten Mittelsitz. Der schwere Geruch des Rotweins macht sich langsam im Abteil breit und der Vinophile packt ein Buch gegen den Kapitalismus aus. Menschen können mich also doch noch überraschen.
Die letzten Kilometer der Fahrt finde ich mich mit meiner Situation sowie deren Geruch ab und genieße den Kontrast, der mir gegenübersitzt. Als ein Ende dieser Odyssee langsam in greifbare Nähe rückt, wischt der Tweed-Mann seinen Papierbecher bedächtig mit einer Serviette aus der Jacketttasche aus und überprüft mittels Umdrehen, ob der Schraubverschluss seinen Weinrest auch sicher in der Flasche hält. Der Andere verstaut tetrismäßig wieder seine Tuppersammlung.
Währenddessen werde ich mir gewahr, dass ich in acht Stunden Bahnfahrt, die sich wesentlich länger angefühlt haben, 60 Kilometer Richtung Süddeutschland geschafft habe, um dann wieder an meinem Startbahnhof anzukommen. Wenn dieser Weg also das Ziel sein soll, komme ich doch lieber an!
Mit dieser Erkenntnis beginnt für mich Trauerphase zwei: Frustration. „Wieso immer ich?!“ Eigentlich mag ich Reisen ganz gerne. Oder zumindest das Ankommen. Das Unterwegssein reizt mich kein bisschen. Vielleicht versuche ich es beim nächsten Mal lieber wieder mit dem FlixBus. Eine Frau, die sich direkt neben mir die Fußnägel lackiert, erscheint mir doch gar nicht mehr so schlimm.
Text: Michelle Ehrhardt
Illustrationen: Ellen Helmecke
