Gestrandet im Nirgendwo. Von der Bahn ausgesetzt und im Stich gelassen. Ohne Handy, nur mit einem Mülleimer als Gesellschaft. Eine aussichtslose Lage. Bis Ulli auftaucht. Mein rauchender Retter. Hustend am Steuer eines goldenen Reisebusses, dessen Passagier:innen einen höheren Altersdurchschnitt haben als jeder Friedhof.
Ich stehe an einem einzelnen langen Gleis, das sich aus mir unbekannten Gründen Bahnhof nennen darf. Nichts an diesem Fleckchen Erde rechtfertigt diesen Titel. Es gibt keine gehetzten Pendler:innen, die verzweifelt versuchen zur Bahn zu sprinten, ohne dabei zu rennen. Auch fehlen die schlechten Bäckereiketten, die meine Not ausnutzen und mir überteuerte, trockene Brezeln verkaufen, nach deren Genuss ich am liebsten eine Hand voll Saharasand gurgeln würde. Ich kann keine Fahrpläne und Anzeigetafeln entdecken. Das Einzige, was mir Gesellschaft leistet, ist ein Mülleimer, der allem Anschein nach weder regelmäßig benutzt noch geleert wird und ein Plakat, das mich dazu aufruft, mich bei der Bahn zu melden, falls die Beleuchtung nicht funktioniert, die es hier offensichtlich gar nicht gibt.
Meine Aufmerksamkeit zieht aber ein rätselhaftes Schild auf sich, das wohl vor vielen Jahrzehnten einmal Aufschluss darüber liefern konnte, wo zum Teufel ich mich hier eigentlich befinde. Heute kann ich hier lediglich einen Bruchteil eines Buchstabens entziffern, der allerdings auch ein Vogelschiss sein könnte. Weit links auf dem dunkelblauen Rechteck erkenne ich einen kleinen Bogen, der sich zur gleichen Seite hin öffnet. Ich fühle mich wieder wie beim Sehtest, den ich gerade so bestanden hatte. So dicht am Durch-die-Prüfung-Rasseln wie damals war ich noch nie. Jetzt trage ich trotzdem Brille und denke angestrengt an nichts anderes als an die möglichen Anfangsbuchstaben des Ortes, an dem ich gestrandet bin. Wie kann dieses Ende der Welt wohl benannt worden sein? Vielleicht irgendwas mit „O“ oder „D“? Möglich wäre auch ein „R“ oder doch ein „B“. Meine Gedanken kreisen durch das Alphabet und versuchen sich angestrengt an passende Ortsnamen zu erinnern. Hätte ich mal in Geografie besser aufgepasst. Aber seit mich meine Geo-Lehrerin aus voller Kehle angeschrien hatte, weil ich meine Überschriften in Schwarz und nicht in Farbe unterstrichen hatte, konnte ich mit diesem Fach nichts mehr anfangen. Dass ich mir als Reaktion darauf einen dunkelgrauen Stift zugelegt hatte, fand sie dann auch nicht witzig.
Oh Gott! Ich fange schon an, in Erinnerungen zu schwelgen. Auf der Kurz-vor-dem-Durchdrehen-Skala steht das unmittelbar vor Selbstgesprächen. Ich bin zu lange allein hier gestrandet. Nur ich, das Gleis und der Mülleimer, von dem ich befürchte, dass er, wenn ich noch länger in dieser Einsamkeit verweile, zu meinem besten Freund und Begleiter wird. Statt vom Meer sind wir umgeben von Bäumen, aber vermutlich ähnlich weit weg von jeglicher Zivilisation. Doch der ein oder die andere mag sich womöglich fragen, wie zur Hölle ich eigentlich in diesem Nichts gelandet bin.

Meine Odyssee nahm damit ihren Anfang, dass ich es nicht abwenden konnte und wieder in die langsamste Regionalbahn der nördlichen Hemisphäre steigen musste, die selbst ein einbeiniger Affe auf einem Einrad bergauf ohne Anstrengung überholen würde. Ich stand also erwartungsvoll am Start-Bahnhof, hatte bisher noch nicht einmal Sichtkontakt mit der Regio, aber schon Verspätung. Ich checkte unaufhörlich die immer größer werdenden roten Zahlen in der DB-App und stellte fest, dass die meisten Menschen, die einst mit mir warteten, die Geduld verloren hatten. Aus einer unübersichtlichen Anzahl an Reisenden wurde ein kleiner überschaubarer Rest, der die Hoffnung und den Glauben an unsere Bimmelbahn noch nicht verloren hatte. Ich für meinen Teil gehöre gewöhnlich auch zu Ersteren, Abtrünnigen, aber ich war verzweifelt und mal wieder auf die unzuverlässigste aller Bahnen angewiesen. Ich beuge mich eben nur einer Macht: diesem beschissenen Zugfahrplan!
Doch dann schob sich endlich die Bahn ganz klein am Horizont immer weiter in meine Richtung. Sie kämpfte sich vorwärts. Für einen kleinen Augenblick meinte ich, einen schwitzenden Lokführer an der Spitze der Lok erkannt zu haben, der das tonnenschwere Gefährt unter größter körperlicher Anstrengung zog. Aber da mussten mich meine mit Freudentränen gefluteten Augen getäuscht haben. Auch ein Motor war imstande eine Bahn so langsam anzutreiben, dass man schon genau hinsehen musste, um überhaupt Bewegung erkennen zu können.
Irgendwann war es so weit: Wir (damit meine ich eine Frau, die das Warten auf einer Bank verschlafen hatte, ihr voll bepacktes E‑Bike und mich) konnten einsteigen. Ich hatte schon gegoogelt, wie lange ich für die Strecke zu Fuß brauchen würde, und kann jetzt schon sagen: Hätte ich das mal gemacht. Aber dafür hatte ich nicht die richtigen Schuhe an. Immerhin konnte ich meinen Platz so frei wählen und es mir richtig gemütlich machen, soweit das diese Sitze, gegen die der elektrische Stuhl recht muckelig aussah, eben zuließen.
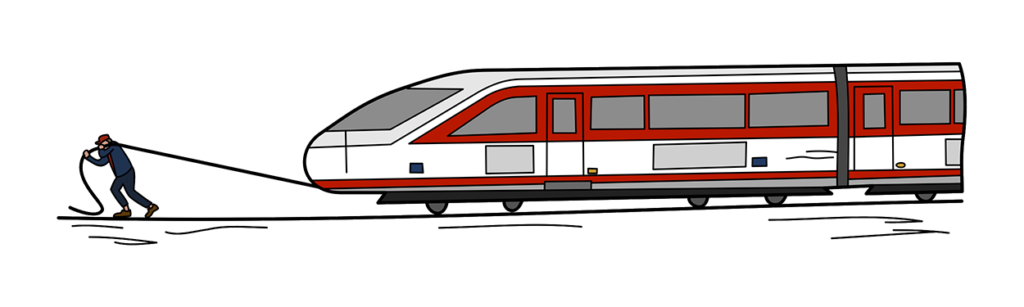
Mir gelang es sogar einzuschlafen, bevor ich etwas von den obligatorisch auftretenden Rückenschmerzen merken konnte. Doch dann wurde ich geweckt. Nicht von einer unverständlich genuschelten Durchsage, die eine Entschuldigung für die Verspätung heuchelte. Nein. Vom Lokführer höchstpersönlich. Ich blinzelte und sah mich etwas verschlafen um. Ich stellte fest: Ich war die letzte übrige Passagierin. Was sich hier eher anfühlte wie die letzte Überlebende.
Der Lokführer fragte mich, wohin es für mich gehen sollte. „Nein! Also bis zur Endstation!?“, sagte der Herr mit entsetzt aufgerissenen Augen. Das mache er aber wirklich nicht für eine Person. Das hier sei jetzt seine Endstation. Ich solle doch bitte aussteigen; er kümmere sich um Ersatz für mich. Ich könne es ja sicher nicht eilig haben, wenn ich mit ihm unterwegs sei. Völlig perplex fand ich mich eben genau hier im Nirgendwo wieder und blickte dem zum Abschied hupenden Zug hinterher, der plötzlich, als ich nicht mehr drinsaß, seine Geschwindigkeit wiedergefunden hatte.
Meine Introvertiertheit war mit der Situation so überfordert, dass sie natürlich in keiner Weise Nachfragen gestellt hatte. Das Einzige, was ich jetzt weiß, ist, dass sich ein nicht sehr motivierter Lokführer vielleicht, vielleicht aber auch nicht um irgendeinen Ersatzverkehr kümmern wollte. Ich versuche nun, durch einen Blick in die DB-App schlauer zu werden, doch als ich meine Verbindung checke, beginnt das Wort „Schienenersatzverkehr“ wild zu blinken, bis sich die App schließt und mein Handy ein letztes Mal hell aufleuchtet. Der Akku ist leer. Natürlich, das habe ich davon, wenn ich ständig checken muss, ob sich Laufen doch lohnen könnte.
Ich stehe also hier an einem Ort irgendwo zwischen Halle und dem bayrischen Kaff, das sowohl mein Ziel als auch meine Heimat ist. Allein ohne Handy und wir wissen doch alle, was meine Generation ohne ihr Smartphone ist. Mir bleibt also nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass hier irgendwann irgendwas mit der großen Aufschrift „Ersatzverkehr“ vorfährt und mich aufnimmt. Wohin es dann geht, ist mir mittlerweile auch schon egal. Es kann nur besser werden (famous last words).

Ich spiele mit dem Gedanken, mich vom „Bahnhof“ zu verabschieden und auf eigene Faust dem schmalen Feldweg, der hierher und dementsprechend auch wegführt, zu folgen. Aber das ist schon in Filmen, die ich nicht gesehen habe, keine gute Idee. Ich bleibe also vorerst. Langsam muss doch die Sonne mal untergehen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich hier schon verweilte. Meine Gedanken werden immer verrückter und ich bin wirklich kurz davor, mit meinem Mülleimer ein tiefgründiges Gespräch über das Nicht-Geliebt-Werden, die Unfairness des Lebens und seine Meinung zum Pfandsystem anzufangen. Aber was ist das?! Ich höre in der Stille, an die ich mich jetzt schon langsam gewöhnt habe, ein Brummen. Es wird lauter. Es klingt nach einem Motor. Ich wage einen Blick zu den Gleisen. Da tut sich nichts. Aber auf dem kleinen Weg hinter mir taucht ein langer Schatten auf. Da kommt etwas Großes auf mich zu und mir wird eins klar: Ich steige da ein! Ich muss hier weg! Selbst wenn mich das in die Arme eines brutalen Mörders treibt. Dann hat das elende Warten wenigstens ein Ende.
Während ich meine sieben Sachen zusammensuche und mich überraschend emotional von dem Mülleimer verabschiede, beobachte ich den Feldweg und den Schatten. Schließlich schiebt sich ein riesiger goldener Reisebus durch die Enge. Und tatsächlich, ich habe schon gar nicht mehr daran geglaubt, aber auf der Anzeige über der Frontscheibe leuchtet in großen Buchstaben „Ersatz“.
Ich laufe also auf meine Rettung in strahlender Lackierung zu und Ulli, der Busfahrer, lehnt bereits lässig an seinem Gefährt und raucht. Woher ich seinen Namen und seine Profession kenne? Ulli macht es mir einfach. Er trägt neben schlabbrigen Hosen und einem Polohemd mit Flecken, von denen ich hoffe, dass es nur Kaffee ist, eine Kappe, bestickt mit einem Bus (wahrscheinlich sein Lieblingsmodell) und seinem Namen in großen Lettern. Vermutlich um jeder Verwirrung zu entgehen, wenn er nicht hinterm Steuer sitzt.
Nachdem er mich in zwei Sätzen dreimal Fräulein und Mädel genannt hat, habe ich es geschafft und kann die steile Treppe hochkletternd einsteigen. Oben angekommen blicke ich in ein Meer aus faltigen Gesichtern und grauen Haaren, welches sich in zwei Lager gespalten hat. Auf der linken Seite tragen alle grüne T‑Shirts mit der Aufschrift: Kleintierzüchter. Die auf der Rechten sind alle in Pink gekleidet und bezeichnen sich ihren Oberteilen zufolge als „Gartenfreunde“. Beide Parteien gehören zum gleichen Dorf, das so unbedeutend ist, dass ich seinen Namen sofort wieder vergessen habe.
Am vorderen Ende des schmalen Ganges stehend, suche ich einen freien Platz. In dem Moment, in dem ich den Blick über die Sitzreihen schweifen lasse, beginnen die ersten Rentner:innen Karamell- oder Eukalyptusbonbons zu zücken und versuchen mich damit anzulocken wie einen Hund. Dazu machen sie natürlich auch die passenden Geräusche. Ich merke schnell, dass hier ein Kampf ausbricht, auf wessen Seite ich mich schlage. Es gibt noch zwei freie Sitze. Einen links, einen rechts. Anscheinend möchte jede der beiden Seiten in den Genuss meiner Gesellschaft kommen. Es werden sich böse Blicke zugeworfen, während ich mich durch den Gang kämpfe. Ich bin noch nicht mal an einem der beiden möglichen Plätze angekommen, um eine Wahl zu treffen, und es werden sich die Top-Ten-Beschimpfungen aus den vergangenen vier Jahrhunderten an die grauhaarigen Köpfe geworfen. Vom klassischen Armleuchter über die kreativere G’witterziege bis hin zum bayrischen Koirawiapostl (für alle, denen das Bayrische fremd ist, hier die Übersetzung: Kohlrabiapostel) oder dem Hundskrippl.
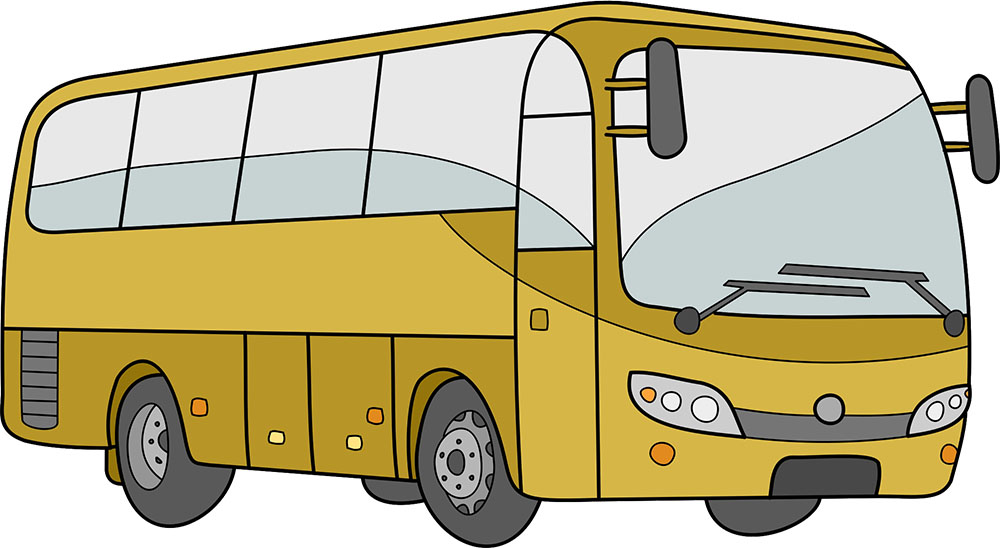
Beleidigungen werden über den Gang geworfen wie Granaten. Der Großteil meiner Mitreisenden muss sich jetzt wohl wieder lebhaft an einen der beiden Weltkriege erinnern, denen sie beigewohnt haben. Wobei hier bei vielen auch der Deutsch-Französische in Frage käme. Ich jedenfalls bin zwischen die Fronten geraten und werde schließlich von einer rettenden Hand aus dem Gemenge, das kurz davor ist, sich zu prügeln, auf einen Sitz gezogen.
In diesem Moment ertönt das widerlichste, verschleimteste Husten, das je ein Ohr vernommen hat, aus den Lautsprechern. Ulli spricht ein Machtwort. Dabei nutzt er sein Husten, das nach einer neuen Lunge schreit, als Signalton vor der Durchsage, wie manche Bahnen eine kurze, freundliche Melodie, die für gute Stimmung sorgen soll, wenn der Lokführer Sekunden später seelenruhig alle verpassten Anschlüsse aufzählt.
Ich verstehe nicht alles, aber anscheinend gibt es schon länger Streit zwischen den beiden Vereinen. Soweit ich das durchblicken kann, geht es um den größeren und besseren Raum im Gemeindehaus. Das ist alles. Zumindest alles, was ich verstehen kann, bevor wieder Ruhe einkehrt und die Beleidigungen langsam harmloser werden, bis sie ganz verstummen. Zur Versöhnung werden aus allen möglichen Jutebeuteln mit Apothekenwerbung, Jacken- und Hosentaschen kleine Flaschen Obstler und Flachmänner gezogen, deren Geruch mir Tränen in die Augen steigen lässt. Die Streitparteien haben wohl eingesehen, dass sich ihr Problem auch auf andere Weise lösen lässt als durch brutale Wortgefechte auf der Rückreise von irgendeiner Gartenschau.

Es wird freudig Alkohol geteilt und durch die Reihen gereicht. Ich lehne dankend ab und begnüge mich mit meiner Hand voll Werther’s Original, die mir unauffällig zugesteckt wurden. Innerhalb weniger Minuten ist die Stimmung von Schulhofschlägerei zu Ballermann gekippt. Was besser ist, weiß ich ehrlich nicht. Doch jetzt zaubert meine Sitznachbarin Waltraud eine Mundharmonika aus ihrer Tasche; die scheint sie für Notfälle immer dabei zu haben. Man kann ja nie wissen, wann das nächste Ständchen ruft. So muss die Hölle klingen.
Waltraud stimmt alle Schlagerhits des letzten Jahrhunderts an, die sie kennt, und sofort beginnt die Stimmung im ganzen Bus zu kochen. Wäre meine Oma nicht schon tot, hätte sie bei dieser Hitparade vor Freude einen Herzinfarkt erlitten. Alles, was das Senior:innen-Schlagerherz begehren kann, ist dabei: von „Griechischer Wein“ über „Santa Maria“ bis „Über sieben Brücken musst du geh’n“. Ich hingegen würde mich lieber von sieben Brücken stürzen.
Während ich so in Todessehnsüchten schwelge, fällt mir auf, dass mir die draußen vorbeiziehende Landschaft doch sehr bekannt vorkommt. Ulli chauffiert uns über die schmalsten Feldwege mit den steilsten Kurven und ich muss feststellen, dass ich hier schon einmal als Kind mit meinem kleinen rosa Fahrrad dramatisch gestürzt bin. Ich kann es kaum fassen. Wir sollten in wenigen Minuten mein kleines Kaff passieren. Aufgeregt kämpfe ich mich zum Busfahrer nach vorne durch die feierwütige Meute und tatsächlich kommt Ulli meiner Bitte nach und möchte mich am Ortseingang rauslassen. Ich kann es kaum fassen, stehe schon bereit an der Tür, und dann soll ich dem Busfahrer doch den Weg zu mir nach Hause beschreiben. Er möchte mich vor der Haustür absetzen. Seine Passagier:innen würden sowieso nicht mehr bemerken, ob sie rechtzeitig ankommen oder nicht.
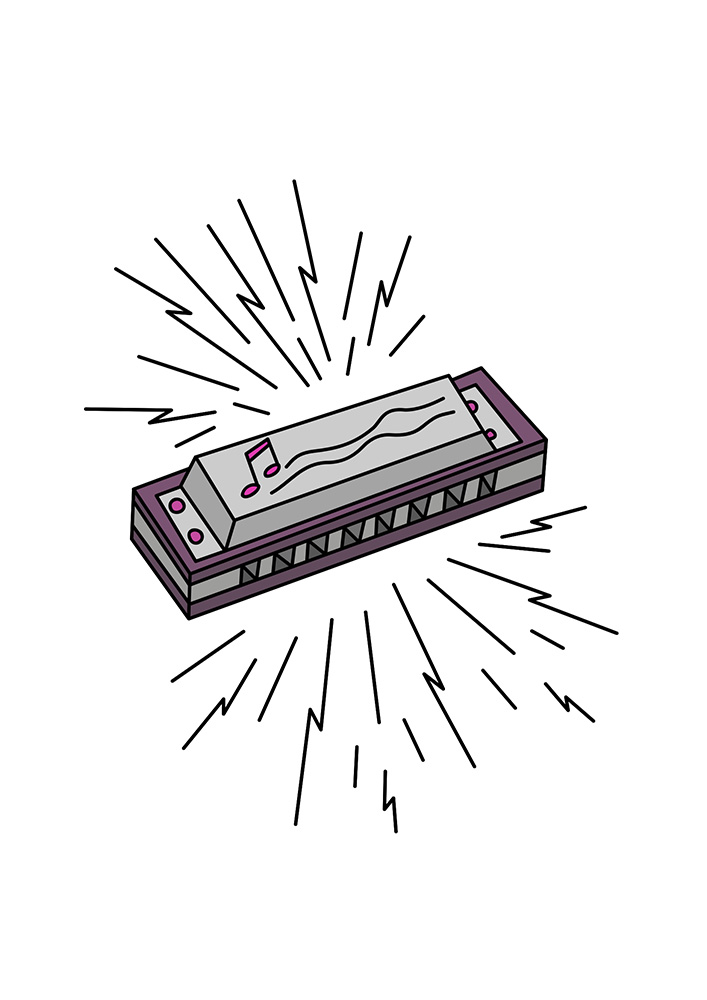
So schlängelt sich der riesige Reisebus unter meiner Wegbeschreibung durch das Minidorf, nur um mich ganz am Ende einer Sackgasse vor meinem Elternhaus aussteigen zu lassen. Ulli wartet sogar noch, bis ich im Inneren verschwunden bin. Wie ich es von meinen Freund:innen gewohnt bin, die auch immer auf Nummer sicher gehen, dass ich es tatsächlich bis ganz nach Hause geschafft habe. So schleimig sein Husten auch war, das rechne ich ihm hoch an. Er bekommt einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Direkt neben der Schaffnerin, die dafür gesorgt hat, dass ich es einmal vor ganz langer Zeit deutsche-Bahn-pünktlich (mit ungefähr zehn Minuten Verspätung) ans Ziel geschafft habe. Ein Engel, gekleidet in dunkelblau und rot.
Text und Illustrationen: Michelle Ehrhardt
