Manchmal reicht es schon, wenn einem auf das aufgeschürfte Knie gepustet wird — und schon tut es kaum noch weh. Bekannt ist das Phänomen aus der Medizin als Placebo-Effekt. Dementsprechend reicht manchmal der Glaube aus, um etwas zu bewirken. Warum Erwartungen heilsam sein und manchmal auch schaden können.
Was ist der Placebo-Effekt?
Ein Placebo oder Scheinmedikament ist ein Arzneimittel, das keinen relevanten Arzneistoff enthält. Somit können diese Medikamente keine pharmakologischen Wirkungen verursachen.
Placebos aktivieren das körpereigene Schmerzabwehrsystem. Die positiven Erwartungen lindern die Schmerzen, indem sie die Ausschüttung von Endorphinen, also körpereigenen Peptiden (Eiweißstoffe), im Gehirn anregen. Die Endorphine hemmen in den Hirnregionen die Schmerzwahrnehmung.

Placebos werden in Form von Dragees, Tabletten und Zäpfchen unter den Handelsnamen P‑Dragees, P‑Tabletten und P‑Suppos vertrieben. Meist handelt es sich bei den Scheinmitteln lediglich um harmlose Zuckerpillen oder Kochsalzlösungen. Im erweiterten Sinn werden auch andere Heilmittel als Placebos bezeichnet, beispielsweise „Scheinoperationen“. Dabei werden nur die Handgriffe ausgeführt, ohne die Behandlung tatsächlich durchzuführen.
Ursprünglich wurden Placebos in klinischen Studien eingesetzt. Sie sollten echte Behandlungen und Nichtbehandlungen vergleichbar machen. Überraschend war aber, dass sich oft auch die Beschwerden der Vergleichsgruppen verbesserten – also derjenigen, die eigentlich eine wirkungslose Substanz, ein Scheinmedikament, erhalten hatten.
Die Erwartungshaltung des Patienten kann also die Wirksamkeit einer Behandlung beeinflussen. Im Durchschnitt reagiert einer von drei Patienten positiv auf Placebos, lautet einer der Glaubenssätze der Medizin.
Woher kommt der Placebo-Effekt?
Die erste Erwähnung in der sogenannte Westlichen Welt findet der Placebo-Effekt nicht durch einen Arzt, sondern durch den griechischen Philosophen Platon (427–347 vor Christus). Er war der Meinung, dass Worte durchaus die Kraft hätten, Kranke zu heilen. Demzufolge zog er in Betracht, einem schwer kranken Patienten durch Worte das Gefühl zu geben, dass er gute Heilungschancen habe oder dass seine Krankheit weitaus weniger schlimm sei, als er denke.
Erst Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Phänomen auch durch Mediziner entdeckt. Ins größere Bewusstsein der Wissenschaft rückte der Placebo-Effekt Anfang der 50er-Jahre durch den Arzt Henry Beecher.
Dieser spielte als Mediziner eine wichtige Rolle bei der Entdeckung und Erforschung des Scheinbehandlungseffekt im Zweiten Weltkrieg. Nachdem ihm das schmerzstillende Morphium ausgegangen war, ersetzte er es durch einfache Kochsalzlösungen, erzählte den verwundeten Soldaten aber weiterhin, dass es Morphium sei, um sie zu beruhigen. Zu seiner Überraschung berichtete fast die Hälfte der Soldaten, dass die inerte Kochsalzlösung ihre Schmerzen tatsächlich linderte oder sogar beseitigte.
Wie wirkt der Placebo-Effekt?
Jahrzehntelang wurden diese als Placebo-Effekt bezeichneten Erkenntnisse als rein psychologisch abgetan. Jetzt deuten neue Forschungsergebnisse darauf hin, dass Placebos echte biologische Veränderungen hervorrufen können – eine Erkenntnis, die die Art und Weise verändert, wie Medizin praktiziert wird.
Über unsere Sinneskanäle erreichen uns Informationen: etwa der Anblick einer Spritze, die uns in den Arm pikst, der bittere Geschmack einer Tablette oder die Aussage des Arztes: „Dieses Medikament wird Ihnen helfen”. Solche Informationen führen automatisch zu bestimmten Erwartungen.
Positive Erwartungen zeigen sich in hoffnungsvollen Gedanken und angenehmen Gefühlen wie Freude und Erleichterung.
Passend dazu konnten Neurowissenschaftler feststellen, dass beim Placebo-Effekt zum einen Hirnregionen aktiviert werden, die mit Denkprozessen zu tun haben (Präfrontaler Cortex) sowieAreale, die der Verarbeitung von Emotionen dienen (Amygdala). Am Ende dieses Schaltkreises steht der Hypothalamus, eine Schaltzentrale im unteren Zwischenhirn, die daraufhin unterschiedliche Prozesse im Körper anstößt. Diese Veränderungen im Körper unterscheiden sich je nachdem, gegen welche Symptome sich der Scheinbehandlungseffekt richtet.
Neben der positiven Einstellung ist die klassische Konditionierung ein sehr entscheidender Mechanismus, wenn es darum geht, wie wirksam das Placebo sein kann. Erwartet ein Patient eine Pille, welche das Immunsystem unterdrückt, nimmt aber immer ein Scheinmedikament ein, löst häufig allein dieses Mittel nach etwas Zeit die gewünschte Wirkung aus.
Der Reiz – in dem Fall das vertraute Aussehen der Pille – aktiviert bestimmte Hirnstrukturen, die über den Hypothalamus in das vegetative Nervensystem eingreifen, welches wiederum das Immunsystem beeinflusst – auf ganz ähnliche Weise wie der echte Wirkstoff.
Eine zentrale Rolle spielt dabei die Milz. Nervenfasern leiten das Signal aus dem Gehirn an das Organ weiter, woraufhin die Milz den Botenstoff Noradrenalin ausschüttet. Der bindet an Rezeptoren der T‑Zellen unseres Immunsystems, was deren Aktivität unterdrückt. Daraus resultiert, dass die überschießende Immunreaktion nachlässt. Entfernt man beispielsweise bei Ratten ein Stück des Milznervs, bleibt bei ihnen die Heilwirkung des Scheinmedikaments gänzlich aus.
Wann ist der Placebo-Effekt besonders stark?
Während manche Menschen sehr stark auf die Zuckerpillen anspringen, reagieren andere kaum darauf. Offenbar führen bestimmte Genvarianten dazu, dass manche Menschen intensiver auf Placebos reagieren als andere. Leichtere Symptome lassen sich zudem in der Regel besser beeinflussen als schwere. Sind bestimmte Hirnfunktionen stark beeinträchtigt – etwa bei Menschen mit Alzheimer-Demenz – dann bleibt der Placebo-Effekt mitunter ganz aus.

Studien zufolge wirken farbige Zuckerpillen effektiver als weiße, kleine und große besser als mittelgroße, und Kapseln besser als Tabletten.
Das Aussehen hat auch Einfluss auf die Art der Wirkung: Blaue Pillen werden als beruhigender empfunden, rote als anregender. Schmeckt eine Pille nach bitterer Medizin, kann das den Effekt zusätzlich verstärken. Auch der vermeintliche Preis hat Einfluss auf die Wirkung: Je teurer die Mittel angeblich sind, desto besser sprechen die Patienten darauf an.
Spritzen und Scheinoperationen, bei denen die Haut nur oberflächlich eingeschnitten wird, und Scheinakupunktur, bei der die Nadeln die Haut nicht wirklich durchstechen, entfalten oft einen noch größeren Placebo-Effekt als Pillen. Hier ist wieder die Erwartung wichtig: Invasive Behandlungsmethoden halten die meisten Menschen nämlich für wirkungsvoller.
Ob der Effekt funktioniert, hängt ganz entscheidend von den Rahmenbedingungen ab, unter denen das Scheinmedikament verabreicht wird. Werden die Mittel von Ärzten verabreicht, so wirken diese stärker, als wenn sie von Pflegern zugeteilt werden. Auch wenn die Placebos wortlos vergeben werden, wirken sie schlechter, als wenn der Arzt dabei auf den Patienten eingeht und ihm zum Beispiel Mut zuspricht.
Wenn ein enges Verhältnis zwischen dem Patienten und Therapeut besteht, wirken Placebos oft besonders gut.
Trotz ihrer positiven Wirkungen sind Scheinmedikamente auch ethisch umstritten.
Wenn Ärzte und Therapeuten ihren Patienten nicht sagen, dass sie Placebos einsetzen, täuschen sie diese. Einen Ausweg aus diesem Dilemma können sogenannte offene Placebos weisen. Dabei wissen die Patienten, dass die Medikamente keinen Wirkstoff enthalten. Bei manchen Beschwerden wirkt ein offen verabreichtes Placebo genauso gut wie ein Placebo, das als Täuschung abgegeben wird. Eine wichtige Rolle bei der Vergabe eines Scheinmedikaments spielen die begleitenden Erläuterungen, wie Psychologen der Universität Basel und der Harvard Medical School im Fachjournal „Pain“ berichten.
Homöopathie vergleichbar mit Scheinmedikamenten?
Homöopathie basiert auf dem Prinzip der Ähnlichkeitsregel und der Potenzierung von Substanzen. Kritiker argumentieren, dass die Wirkung homöopathischer Mittel hauptsächlich auf dem Placebo-Effekt beruht, da die Verdünnung der Wirkstoffe so hoch ist, dass sie keine nachweisbare pharmakologische Wirkung haben.
Einige Studien deuten drauf hin, dass der positive Effekt der Homöopathie auf den Glauben und die Erwartungen der Patienten zurückzuführen sein könnte, ähnlich wie beim Placebo-Effekt. Es gibt jedoch weiterhin kontroverse Diskussionen über den Mechanismus der Homöopathie.
Verschiedene Arten von Placebos
Es wird zwischen echten beziehungsweise reinen, aktiven und Pseudo-Placebos unterschieden. Echte oder reine Placebos sind die Scheinmedikamente, die aus Zucker und Stärke zusammengesetzt sind. Ebenso können aber auch Hilfsstoffe für Geschmack und Stabilität oder Farbstoffe enthalten sein. Echte oder reine Placebos können auch spezielle Placebo-Akupunkturnadeln sein, die nicht durch die Haut stechen, sondern lediglich in einen sogenannten Nadelhalter eingefahren werden, der dann auf der Haut kleben bleibt.
Zu den aktiven Placebos gehören Tabletten, die für besondere klinische Prüfungen eingesetzt werden. Diese haben nicht die Wirkung von einem Medikament, sondern ahmen nur dessen Nebenwirkungen nach. Aktive Placebos werden beispielsweise in der Untersuchung von Morphin zur Behandlung neuropathischer Schmerzen eingesetzt.
Pseudo-Placebos hingegen sind Medikamente, die im konkreten Anwendungsfall nach aktueller wissenschaftlicher Erkenntnis nicht wirken können. Grund dafür ist wahrscheinlich die geringe verabreichte Dosis oder das Wirkungsspektrum, welches keinen spezifischen Einfluss auf die bestehende Krankheit hat.
Neben den verschiedenen Arten des Scheinmedikaments und dessen Wirkungsweisen gibt es bei Kindern und Tieren einen weiteren Wirkmechanismus: “Placebo by proxy”. Hier vermittelt den Effekt eine andere Person, die mit einer Wirkung rechnet. Die Eltern beziehungsweise Tierhalter benehmen sich beispielsweise optimistischer und entspannter, was sich günstig auf den Krankheitsverlauf auswirkt.
Das Gegenstück zum Placebo-Effekt
Die Behandlung mit einem Scheinmedikament kann allein durch die Erwartung genauso wie bei einem echten Medikament auch Nebenwirkungen auslösen.
Wissenschaftler sprechen vom Nocebo-Effekt. Nocebo heißt übersetzt „Ich werde schaden“, im Gegensatz zu Placebo: „Ich werde gefallen“. Der Nocebo-Effekt ist das negative Gegenstück zum Placebo-Effekt.
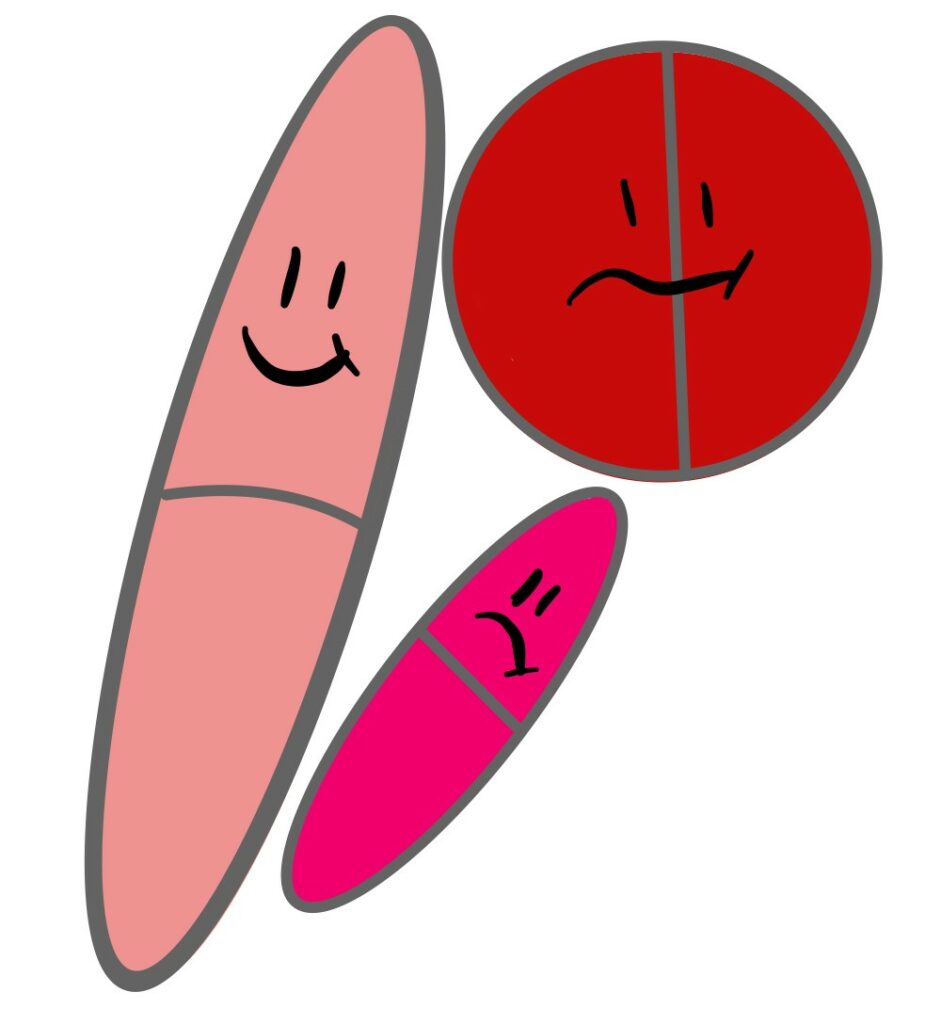
Er beschreibt unerwünschte Nebenwirkungen einer Scheinbehandlung – wenn sie also nicht heilt, sondern Beschwerden verschlimmert oder erst hervorruft.
Im Gegensatz zur positiven Wirkung beim Placebo-Effekt sorgt beim Nocebo-Effekt allein die Erwartung negativer Folgen dafür, dass diese tatsächlich zu spüren sind. Die Erwartungshaltung kann demnach auch unbewusst sein und auf Lernmechanismen wie zum Beispiel Konditionierungen beruhen. So kann beim Patienten die Befürchtung aufgebaut werden, dass bestimmte äußere Einwirkungen „krank machen“.
Nocebo-Symptome treten signifikant häufiger bei Frauen als bei Männern auf. Ebenso ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er bei älteren Menschen vorkommt als bei jüngeren.
Studien haben gezeigt, dass die Nocebo-Effekte nicht unspezifisch sind. Die ausgelösten Beschwerden spiegeln tatsächlich die Beschwerden wider, die als Nebenwirkung im Risikogespräch geschildert wurden. Aufgrund dessen nehmen Patienten Medikamente zum Teil nicht mehr ordnungsgemäß ein oder brechen die Therapie ab. Angst, Stress und Pessimismus – ausgelöst durch die Risikoaufklärung – können großen Einfluss auf das Behandlungsergebnis haben.
Lässt sich der Nocebo-Effekt vermeiden?
Eine zentrale Rolle spielt das Patientengespräch. Sind die Nocebo-Effekte bekannt, kann das Gespräch weniger traumatisierend gestaltet werden, indem die Risiken nicht noch einmal ausführlich dargelegt werden, denn durch Wiederholungen können sich Nocebo-Effekte verstärken. Zudem sollten Missverständnisse vermieden werden und Aussagen klar und positiv formuliert werden. Alternative Szenarien könnten aufgezeigt werden und man kann erläutern, welche prophylaktischen Maßnahmen empfohlen werden oder wie man bei möglichen Nebenwirkungen schnell einschreiten und die Beschwerden somit mindern kann.
Warum gibt es den Beipackzettel?
Bei jeder medizinischen Behandlung mischt die Psyche mit. Wenn man erwartet, dass eine Pille hilft, dann hilft sie in der Regel auch – zumindest ein wenig. Selbst dann, wenn kein Wirkstoff drinsteckt. Beim Nocebo-Effekt, der vor allem durch Pessimismus und Angst ausgelöst wird, ist es umgekehrt.
Aber wenn das so ist: Warum lässt man die langen Listen mit Nebenwirkungen nicht einfach weg?
Das ist einfacher gesagt als getan. Angenommen, es gäbe keinen Beipackzettel und man würde ständig Nebenwirkungen bekommen, ohne zu wissen, von welchem Medikament diese genau kommen. Dann nimmt man im schlimmsten Fall das Medikament weiter ein, bis verheerende Folgen auftreten.
Die Hersteller sind verpflichtet, auf einem Beipackzettel alles aufzulisten, was für den Patienten wichtig sein könnte. Dazu gehören eben auch alle denkbaren Nebenwirkungen, selbst sehr seltene – und sogar Beschwerden, die möglicherweise nur zufällig zur gleichen Zeit auftreten werden. Die Packungsbeilage in der Packung stecken zu lassen und sich erst gar nicht darüber zu informieren, ist aber auch keine Lösung. Schließlich stehen auf dem Beipackzettel auch weitere wichtige Informationen, zum Beispiel wie oft und in welcher Dosis man das Medikament nehmen sollte. Auch wann es gar nicht geeignet ist oder mit welchen anderen Mitteln es sich nicht verträgt, steht auf der Gebrauchsinformation.
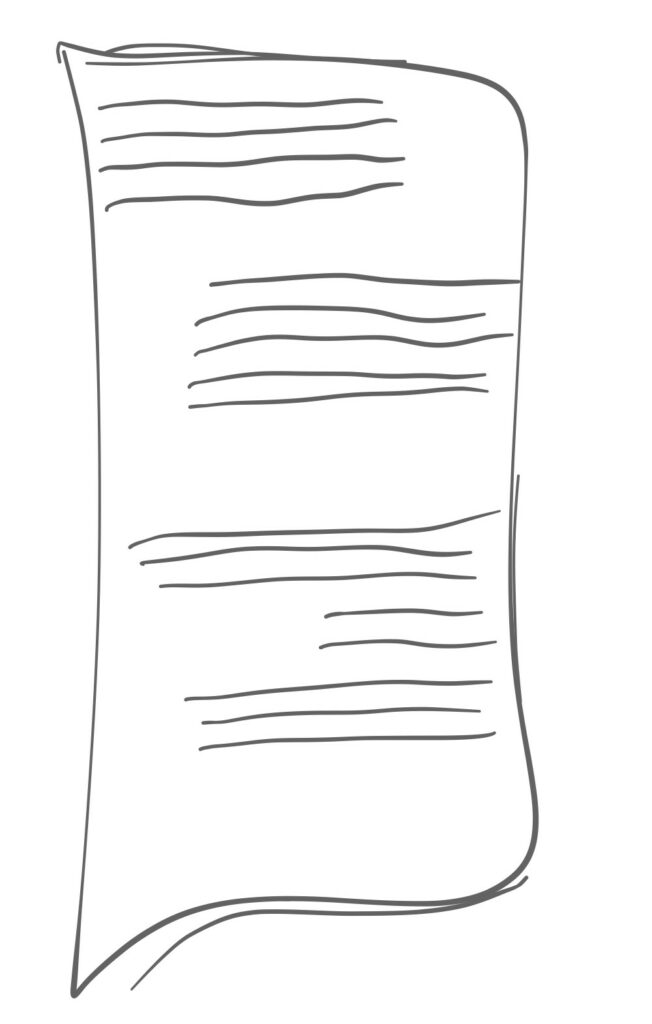
Sollte man also dazu neigen, mit einer pessimistischen Einstellung Tabletten einzunehmen, dann sollte man doch lieber in der Apotheke oder Arztpraxis nachfragen, ob es etwas Wichtiges zu beachten gibt. Und wenn man das nächste Mal leichte Kopfschmerzen haben sollte, kann man sich auch erst einmal hinlegen, bevor man eine Pille schluckt.
Am Ende bleibt bei Placebo-Anwendungen die Tablette lediglich eine Zuckerpille und die Infusion nur eine Kochsalzlösung. Empfehlenswert sind Placebos, wenn die Beschwerden des Patienten nicht zu schlimm sind und es kein nachweislich wirksames Medikament gibt. Auch bei den Scheinoperationen muss der Mediziner abschätzen können, inwieweit diese sinnvoll sind. Das Placebo, egal ob Tablette oder Scheinoperation, ersetzt auf gar keinen Fall den realen Eingriff oder den realen Wirkstoff.
Text, Foto und Illustrationen: Amelie Sander
